Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.

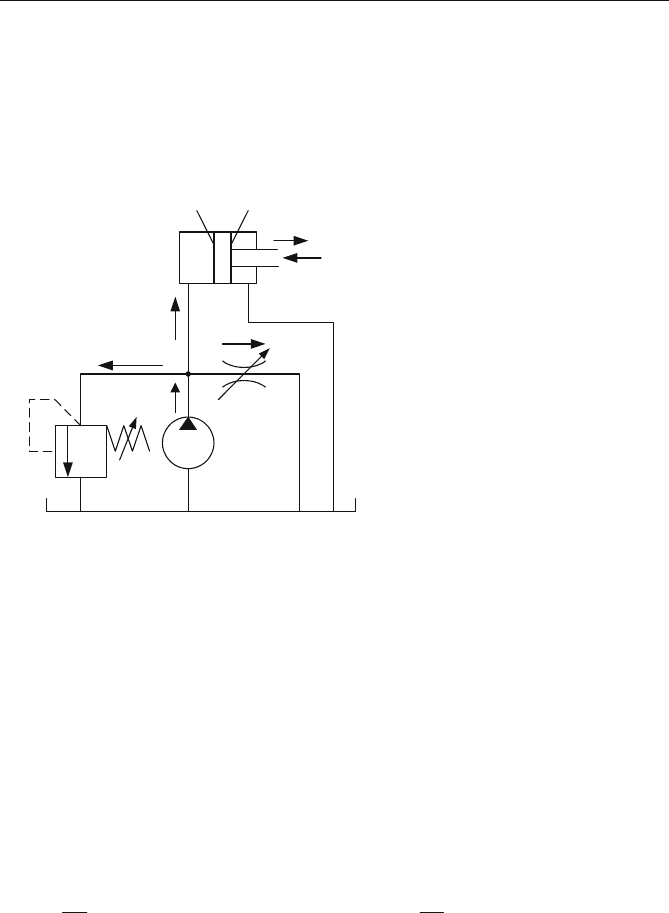
118 5 Grundstrukturen hydraulischer Kreisläufe
5.4.2 Drosselkreisläufe mit Volumenstromquelle
Eine weitere Möglichkeit der Anwendung von Stromventilen ist ihre Anordnung
im Nebenschluss zum Verbraucher. Abbildung 5.8 zeigt eine derartige Schaltung
mit einem Drosselventil.
A
1
A
2
v
F
Q
Dr
p
Q
1
Q
VD
= 0
Q
P
p
e
Abb. 5.8 Drosselkreislauf mit Volumenstromquelle
Soll ein Stromregelventil zur Vermeidung der Abhängigkeit der Kolben-
geschwindigkeit v von der Kraft F anstelle des Drosselventils eingesetzt werden,
ist ein Drei-Wege-Stromregelventil (Abschn. 8.2.2) in der Leitung zum Arbeits-
zylinder anzuordnen. Beim Einsatz eines Zwei-Wege-Stromregelventils in der
Nebenschlussleitung wird der zum Behälter abfließende Volumenstrom Q
Dr
genau
dosiert, während der zum Arbeitszylinder führende Volumenstrom Q
1
durch die
Leckverluste der Pumpe beeinflußt wird. Damit ergibt sich trotz des Einsatzes ei-
nes Zwei-Wege-Stromregelventils eine Abhängigkeit der Kolbengeschwindigkeit
v von der Last F.
Anstelle des Arbeitszylinders kann ein Rotationsmotor als Verbraucher ein-
gesetzt werden.
Zur Speisung der Anlage ist eine Volumenstromquelle erforderlich. Die Kol-
bengeschwindigkeit v wird durch das Drosselventil eingestellt. Es gilt:
v
Q
A
1
1
mit Q
1 =
Q
P
- Q
Dr
und 'pp
F
A
Dr
1
. (5.14)
Das Druckbegrenzungsventil dient als Sicherheitsventil (p
p
e
; Q
VD
= 0). Ein Pa-
rallelbetrieb mehrerer Verbraucher ist deshalb nicht möglich.
Diese Anordnung des Stromventils im Kreislauf erfordert für jeden Ver-
braucher eine eigene Volumenstromquelle. In Bewegungsrichtung des Kolbens
wirkende Kräfte sind, da in diesem Fall der Druck p negativ werden müsste
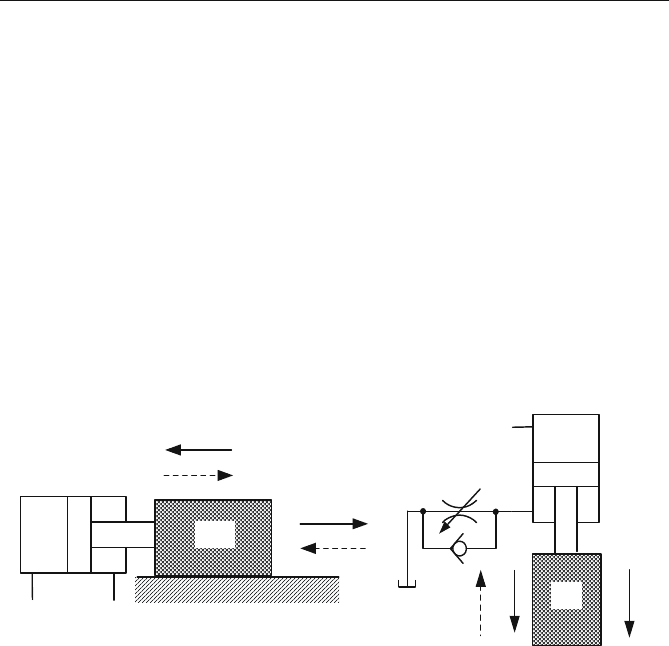
5.5 Passive und aktive Lasten 119
(Kavitation), zu vermeiden; dadurch würde die Anlage funktionsuntüchtig. Ein
Gegendruckventil in der Abflussleitung vom Verbraucher beseitigt die
Kavitationsgefahr. Damit wird jedoch der Anlagenwirkungsgrad verschlechtert.
5.5 Passive und aktive Lasten
Die von Hydraulikantrieben zu überwindenden Lasten (Kräfte und Momente)
können anlagenabhängig unterschiedliche Forderungen an die Gestaltung des Hy-
draulikkreislaufes stellen. Es ist zu unterscheiden zwischen passiven und aktiven
Lasten.
In Abb. 5.9 sind Beispiele für diese beiden Lastarten an Antrieben mit Arbeits-
zylindern dargestellt. Die folgenden Aussagen gelten analog für Antriebe mit Ro-
tationsmotoren.
m
v
m g
m
- v
F
- F
a
m
v
-v
b
Abb. 5.9 Lastarten. a passive Last b aktive Last
Passive Lasten
Passive Lasten wirken stets entgegen der Bewegungsrichtung des Arbeitszylinders
bzw. des Rotationsmotors.
In Abb. 5.9 a wird als Beispiel für eine passive Last die Wirkung der Reibkraft
zwischen der zu bewegenden Masse m und der feststehenden Unterlage dar-
gestellt. Eine Umkehr der Bewegungsrichtung führt zu einer Umkehr der auf den
Kolben des Arbeitszylinders (Abb. 5.9 a) wirkenden Kraft F. Beim Druckaufbau
zur Überwindung der Haftreibung ist auch bei Stillstand des Antriebes die auf den
Kolben wirkende Reibkraft der Richtung der beabsichtigten Bewegung entgegen-
gesetzt.
Passive Lasten können keine Energie in das Hydrauliksystem einspeisen. Sie
werden durch Reibungskräfte bzw. -momente oder durch Arbeitswiderstände, wie
Zerspankräfte o.ä., verursacht.

120 5 Grundstrukturen hydraulischer Kreisläufe
Aktive Lasten
Aktive Lasten wirken bei stationärer Bewegung unabhängig von der Bewegungs-
richtung und auch bei Stillstand stets in einer Richtung. Eine Bewegungsumkehr
hat demzufolge keinen Einfluss auf die Richtung der Kraft auf den Kolben des
Arbeitszylinders. Deshalb sind spezielle schaltungstechnische Maßnahmen zum
Aufbau eines Gegendruckes im entsprechenden Zylinderraum bei Bewegung in
Lastrichtung erforderlich.
Im Beispiel nach Abb. 5.9 b dient dazu das beim Senken wirksame Drossel-
ventil, welches beim Heben durch das parallelgeschaltete Rückschlagventil um-
gangen wird.
Aktive Lasten können Energie in das Hydrauliksystem einspeisen. Sie werden
z. B. durch Federn und Gewichte verursacht. Auch Trägheitskräfte, die bei in-
stationärer Bewegung auftreten, sind den aktiven Lasten zuzuordnen. Sie wirken
unabhängig von der Bewegungsrichtung stets entgegen der Beschleunigungs-
richtung. Bei Bremsvorgängen wirkt die Trägheitskraft in Bewegungsrichtung. In
im offenen Kreislauf arbeitenden Hydraulikanlagen für Winden,
Hubeinrichtungen und andere Geräte, bei denen aktive Lasten auftreten können,
werden anstelle des Drosselventils nach Abb. 5.9 b spezielle Senkbremsventile,
welche die Absenkgeschwindigkeit lastunabhängig konstant halten, eingesetzt
(siehe Kap. 14). Für im geschlossenen Kreislauf arbeitende Anlagen sind Senk-
bremsventile nicht erforderlich.
6 Pumpen und Motoren
Zu den hydraulischen Verdrängermaschinen (Hydromaschinen) gehören Pumpen
und Motoren. Beide arbeiten nach dem Verdrängerprinzip und haben in der Regel
den gleichen konstruktiven Aufbau. Pumpen können als Motoren arbeiten und
umgekehrt, wenn der Flüssigkeitsstrom entsprechend gesteuert wird. Durch den
Unterschied in der Wirkungsrichtung gilt für Hydropumpen, dass sie mechanische
in hydraulische Leistung umwandeln und Hydromotoren hydraulische Leistung in
mechanische Leistung zurückwandeln. Beide sind gekennzeichnet durch das geo-
metrische Verdrängungsvolumen V.
Der theoretische Volumenstrom Q
th
, der je Zeiteinheit durch diese Maschinen
strömt, ergibt sich aus der Gl. (6.1), mit der Drehzahl n und den Verdrängungs-
volumen V
nVQ
th
.
(6.1)
Die Pumpe saugt die Hydraulikflüssigkeit an und verdrängt diese in das Leitungs-
system. Durch die Widerstände, die der strömenden Flüssigkeit entgegenwirken,
baut sich im gesamten Hydrauliksystem ein Druck auf. Damit wird deutlich, dass
sowohl bei Schwankungen der äußeren Last an Zylindern oder Motoren, als auch
bei Veränderungen des Volumenstromes und/oder der Viskosität der Hydraulik-
flüssigkeit, sich unmittelbar schwankende Drücke einstellen.
Erwähnenswert ist, dass mit Freikolbenmaschinen (Brennkolbenpumpe), die ei-
ne direkte Energieumwandlung von thermischer über mechanische in hydraulische
Energie ermöglichen, Forschungsprojekte betrieben werden. Da diese Maschinen
immer im optimalen Betriebspunkt laufen, sind energetische Effekte zu erwarten
[6.1]. Es handelt sich dabei nicht um reine hydraulische Systeme, die hydraulische
Energie wird aber letztlich durch hydraulische Verdrängereinheiten bereitgestellt.
6.1 Einteilung
Grundsätzlich gibt es die nachfolgend dargestellten Möglichkeiten der konstrukti-
ven Einteilung von Verdrängereinheiten:
Umlaufverdränger-(Drehkolben-)maschinen
Umlaufverdrängermaschinen fördern die Hydraulikflüssigkeit durch Drehung von
Zahnrädern, Kammern oder Zellen. Zu den bekanntesten Bauarten gehören Zahn-
radmaschinen, Schraubenmaschinen und Flügelzellenmaschinen. Letztere gibt es
mit variablem und konstantem Verdrängungsvolumen.
D. Will, N. Gebhardt (Hrsg.), Hydraulik,
DOI 10.1007/978-3-642-17243-4_6, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
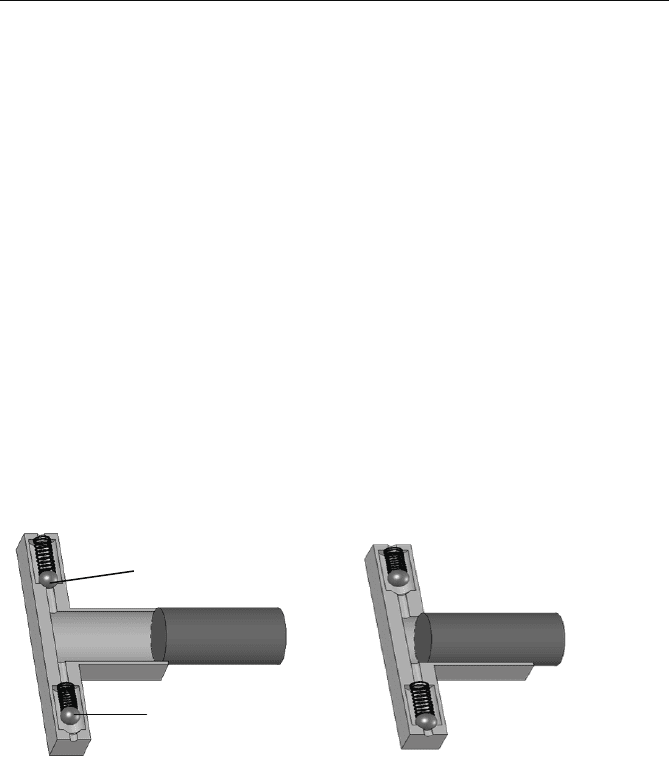
122 6 Pumpen und Motoren
Hubverdränger-(Schubkolben-)maschinen
Bei Hubverdrängermaschinen wird die zyklische Veränderung der Zellengröße
durch längsbewegte Kolben erreicht. Eine Verstellung des Verdrängungsvolumens
ist durch Eingriff in die Triebwerksgeometrie möglich. Bedingt durch die innere
Strömungsumkehr des Fluids benötigen diese Maschinen eine Schieber- oder Ven-
tilsteuerung zwischen dem Verdrängungsraum und den Strömungswegen. Als we-
sentliche Bauarten sind hier Axialkolben- und Radialkolbenmaschinen zu nennen,
die es mit variablem und konstantem Verdrängungsvolumen gibt.
Die beiden grundlegend unterschiedlichen Bewegungsarten führen zu ab-
weichenden Eigenschaften, die spezifische Einsatzcharakteristika zur Folge haben.
Ein Umlaufverdränger kann mit einer höheren Drehzahl als ein Hubverdränger be-
trieben werden, weil bei ihm keine Umkehrung der Bewegungsrichtung des Ver-
drängers zwischen Ansaugen und Ausschieben erfolgen muss. Umlaufverdränger
haben höhere Verlustströme als Hubverdränger und deshalb einen niedrigeren vo-
lumetrischen Wirkungsgrad. Sie werden vor allem bei niedrigen Drücken ein-
gesetzt. Eine Hauptursache für die größeren Leckverluste ist der Zusammenhang
zwischen der Form der Dichtungslinien und den auftretenden Drücken in den Um-
laufverdrängern. Die Begrenzungslinien zwischen den feststehenden und den be-
weglichen Teilen sind Geraden. In modernen Maschinen werden die Nachteile
durch größere Fertigungsgenauigkeiten und Verwendung von hochwertigen Le-
gierungselementen weitestgehend ausgeglichen.
a
b
Abb. 6.1 Wirkschema von Hubverdrängermaschinen. a Saughub b Förderhub
Das Grundprinzip von Hubverdrängermaschinen wird in Abb. 6.1 verdeutlicht.
Beim Ausfahren des Kolbens (Saughub) baut sich im Zylinder ein Unterdruck auf.
Dieser bewirkt, dass über das Saugventil 1 die Hydraulikflüssigkeit aus dem Be-
hälter der Hydroanlage angesaugt wird. Durch den Druck in dem Hydraulikkreis-
lauf bleibt das Druckventil 2 in geschlossener Position. Beim Einfahren (Förder-
hub) des Kolbens wird das Fluid über das Druckventil unter Druck (hier abhängig
von der Federkraft des Druckventils und von dem in der Leitung herrschenden
Druck) in die Hydraulikanlage gefördert. Der Druck im Zylinder sorgt dafür, dass
das Saugventil geschlossen bleibt. Anstelle der in Abb. 6.1 gezeigten druck-
abhängigen Steuerung erfolgt bei den meisten Hydromaschinen die Steuerung
wegabhängig (vgl. Abb. 6.24 a).
1
2

6.2 Kenngrößen 123
Darüber hinaus gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, die Unterteilung nach
dem Verdrängungsvolumen bzw. der Art des Verdrängerprinzips vorzunehmen:
konstantes Verdrängungsvolumen bzw.
veränderbares Verdrängungsvolumen.
6.2 Kenngrößen
Hydromaschinen bestehen aus vielen Einzelteilen mit mehreren Dichtspalten zwi-
schen den bewegten Teilen. Zwangsweise treten an diesen Stellen druckabhängige
volumetrische Verluste auf, die zu einem inneren Leckvolumenstrom Q
Li
führen
können. Der Anteil, der aus dem Gehäuse durch eine gesonderte Leckleitung ab-
geführt wird, wird als äußerer Leckvolumenstrom Q
La
bezeichnet. Mit Gl. (6.2)
kann der Zusammenhang zwischen den Leckvolumenströmen hergestellt werden.
Aus Abb. 6.2 geht hervor, dass sich dadurch für Pumpen gegenüber den theoreti-
schen Werten ein geringerer Förderstrom ergibt bzw. für Motoren ein größerer
Volumenstrom zugeführt werden muss, damit die vorgegebene Drehzahl erreicht
wird
LaLiL
QQQ .
(6.2)
Für den realen messbaren Volumenstrom Q (
P
Q bzw.
M
Q ) müssen neben dem
Anteil, der mit den Leckagen erfasst wird, zusätzlich die sich aus unvollständiger
Füllung infolge von Kavitation, Gas- oder Dampfeinschlüssen in der Flüssigkeit
Q
S
sowie der Verluststrom Q
K
, der bei Druckanstieg infolge der Kompressibilität
der Flüssigkeit entsteht, berücksichtigt werden. Während sich der Förderstrom von
Pumpen aus Gl. (6.3) ergibt, wird der für Motoren erforderliche Volumenstrom
mit Gl. (6.4) erfasst
KSLthP
QQQQQ
(6.3)
KLthM
QQQQ .
(6.4)
P
Q - realer messbarer Volumenstrom von Hydropumpen
M
Q - der zur Erreichung einer messbaren Drehzahl von Hydromotoren erfor-
derliche Volumenstrom
Da der Verluststrom Q
S
unerwünscht ist, sollte sein Einfluss so gering wie mög-
lich gehalten werden. Für vorgespannte Pumpen und für Motoren ist er ver-
nachlässigbar. Dieser Sachverhalt stellt für die am häufigsten eingesetzten
Hydraulikmaschinen einen Sonderfall dar. Bei selbstansaugenden Pumpen ist
darauf zu achten, dass der Unterdruck in der Saugleitung möglichst niedrig ge-
halten wird (geringe Saughöhe, ausreichend große Rohrquerschnitte, Vermeidung
örtlicher Widerstände) und keine Luft angesaugt werden kann (s. Kap. 4).
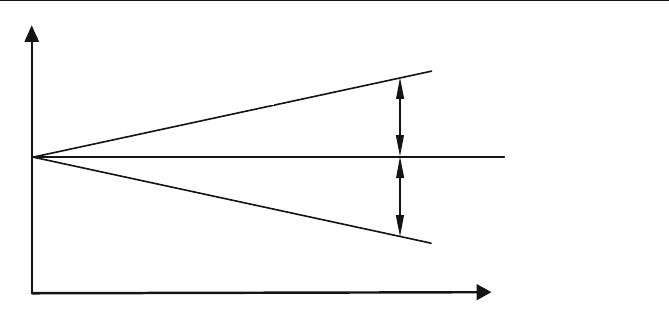
124 6 Pumpen und Motoren
Q
Q
p
p
Q
Q
L
L
Q
Q
M
M
Q
Q
L
L
Q
Q
P
P
Q
Q
t
t
h
h
n
n
=
=
k
k
o
o
n
n
s
s
t
t
.
.
T
T
=
=
k
k
o
o
n
n
s
s
t
t
.
.
Abb. 6.2 Leckvolumenströme von Hydromaschinen in Abhängigkeit vom Druck
Der Kompressionsstrom Q
K
kann in Hydromotoren, ebenso wie in Hydro-
pumpen, in der Regel nicht genutzt werden und wird damit zu einem irreversiblen
Verlustanteil. Unter der Annahme konstanter Füllungs- und Kompressionsverluste
gelten für einen konstanten Betriebszustand die in Abb. 6.2 dargestellten Sachver-
halte.
Für die in Pumpen und Motoren umgesetzten Leistungen ist von dem nach-
folgend dargestellten allgemeinen Sachverhalt auszugehen (s. Abschn. 4.8). Die
mechanische Leistung, die der Antriebsleistung von Pumpen und der Abgabe-
leistung bei Motoren entspricht, kann mit Gl. (6.5) berechnet werden
nMMP
S
Z
2
Z
anPanP
MP
Z
abMabM
MP . (6.5)
Die hydraulische Leistung, die der Abgabeleistung von Pumpen bzw. der An-
triebsleistung von Motoren entspricht, wird gemäß Gl. (6.6) berechnet
pQP '
pQP
PabP
' pQP
ManM
' .
(6.6)
Dabei stellen M das Drehmoment, n die Drehzahl und
'
p die Druckdifferenz zwi-
schen hydraulischem Eingang und Ausgang der Verdrängermaschine dar.
Das Produkt aus maximalem Volumenstrom Q und maximalem Druck p wird
als Eckleistung einer Verdrängermaschine bezeichnet. Bei genereller Auslegung
der Hydraulikanlage nach der Eckleistung ergeben sich für den oft genutzten Teil-
lastbereich zu große und damit zu teure Baugruppen. Es werden deshalb zu-
nehmend Regelsysteme eingesetzt, die einen Leistungsregler verwenden, der die
Maximalleistung unterhalb der Eckleistung begrenzt (s. Abschn. 6.5).
Die Umwandlung von mechanischer Leistung in hydraulische und umgekehrt
kommt mit Gl. (6.7) zum Ausdruck
pQMP
ththth
'
Z
.
(6.7)
Wird in Gl. (6.7) der aus Gl. (6.1) bekannte Sachverhalt für den Volumenstrom
eingesetzt, so ergibt sich Gl. (6.8) für das theoretische Drehmoment von Ver-
drängermaschinen
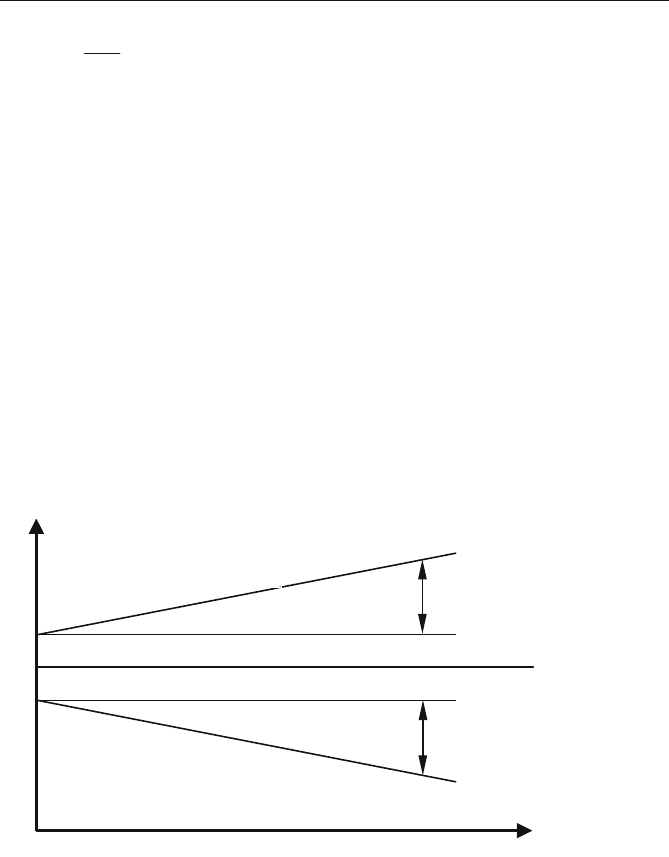
6.2 Kenngrößen 125
p
V
M
th
'
S
2
.
(6.8)
Bei stationärem Betrieb dieser Maschinen sind die folgenden Verlustmomente zu
berücksichtigen:
Z
R
M Verlustmoment durch Newtonsche Reibung,
Rc
M Verlustmoment durch Coulombsche Reibung,
Rp
M Verlustmoment durch Stoß- und Massenkräfte und andere Einflüsse.
Damit gilt für das
Antriebsmoment von Pumpen M
P
der in Gl. (6.9) dargestellte
Zusammenhang. Mit Gl. (6.10) kann hingegen das
Abtriebsmoment von Motoren
M
M
berechnet werden
RcRpRthP
MMMMM
Z
(6.9)
RcRpRthM
MMMMM
Z
.
(6.10)
Die sich aus diesen Gleichungen ergebenden Kennlinien sind in Abb. 6.3 dar-
gestellt.
M
M
n
n
M
M
R
R
Z
Z
M
M
R
R
Z
Z
M
M
P
P
M
M
M
M
M
M
R
R
p
p
+
+
M
M
R
R
c
c
M
M
R
R
p
p
+
+
M
M
R
R
c
c
M
M
t
t
h
h
T
T
=
=
k
k
o
o
n
n
s
s
t
t
.
.
'
'
p
p
=
=
k
k
o
o
n
n
s
s
t
t
.
.
Abb. 6.3 Momentenkennlinien von Hydromaschinen
Betrachtet man die in Abb. 6.4 dargestellten Verlustkomponenten, so können
daraus die Beziehungen für den Wirkungsgrad von Verdrängermaschinen ab-
geleitet werden. Der Gesamtwirkungsgrad
K
wird aus dem Produkt der Einzel-
wirkungsgrade mit Gl. (6.11) berechnet
mv
K
K
K
.
(6.11)
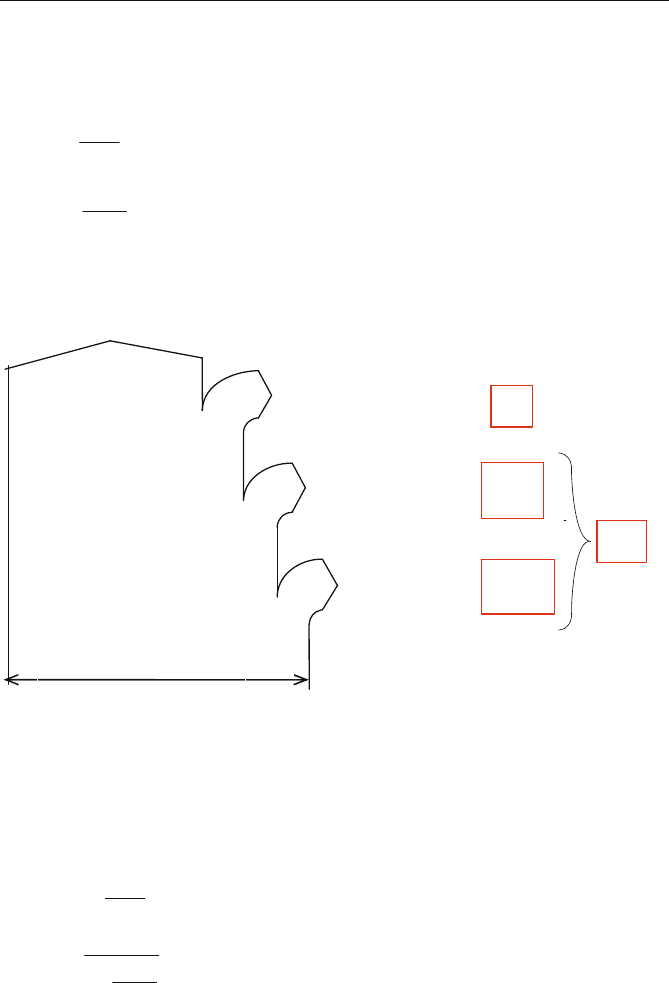
126 6 Pumpen und Motoren
Der volumetrische Wirkungsgrad
K
v
erfasst alle Leckagen, die an Dichtstellen in-
nerhalb der Hydromaschinen auftreten. Er wird mit der Gl. (6.12) für Pumpen und
mit Gl. (6.13) für Motoren berechnet
thP
P
vP
Q
Q
K
(6.12)
M
thM
vM
Q
Q
K
.
(6.13)
Abb. 6.4 Verluste an Hydropumpen
Bei Vernachlässigung der Füllungs- und Kompressionsverluste werden unter prak-
tischen Bedingungen die volumetrischen Wirkungsgrade mit den Gln. (6.14) und
(6.15) berechnet
thP
L
vP
Q
Q
1
K
(6.14)
thM
L
vM
Q
Q
1
1
K
.
(6.15)
Der theoretische Volumenstrom
Q
th
ergibt sich für Pumpen und Motoren aus Gl.
(6.1). Der äußere Leckvolumenstrom
Q
La
wird in einer separat vorhandenen Leck-
(
(
h
h
y
y
d
d
r
r
a
a
u
u
l
l
i
i
s
s
c
c
h
h
e
e
L
L
e
e
i
i
s
s
t
t
u
u
n
n
g
g
)
)
z
z
u
u
g
g
e
e
f
f
ü
ü
h
h
r
r
t
t
e
e
L
L
e
e
i
i
s
s
t
t
u
u
n
n
g
g
a
a
m
m
P
P
u
u
m
m
p
p
e
e
n
n
e
e
i
i
n
n
g
g
a
a
n
n
g
g
R
R
e
e
i
i
b
b
u
u
n
n
g
g
s
s
v
v
e
e
r
r
l
l
u
u
s
s
t
t
e
e
r
r
e
e
i
i
n
n
m
m
e
e
c
c
h
h
a
a
n
n
i
i
s
s
c
c
h
h
R
R
e
e
i
i
b
b
u
u
n
n
g
g
s
s
v
v
e
e
r
r
l
l
u
u
s
s
t
t
e
e
i
i
m
m
F
F
l
l
u
u
i
i
d
d
u
u
n
n
d
d
z
z
w
w
i
i
s
s
c
c
h
h
e
e
n
n
F
F
l
l
u
u
i
i
d
d
u
u
n
n
d
d
W
W
a
a
n
n
d
d
L
L
e
e
c
c
k
k
v
v
e
e
r
r
l
l
u
u
s
s
t
t
e
e
a
a
n
n
D
D
i
i
c
c
h
h
t
t
u
u
n
n
g
g
s
s
s
s
p
p
a
a
l
l
t
t
e
e
n
n
(
(
S
S
u
u
m
m
m
m
e
e
d
d
e
e
r
r
L
L
e
e
c
c
k
k
a
a
g
g
e
e
n
n
)
)
L
L
e
e
i
i
s
s
t
t
u
u
n
n
g
g
a
a
m
m
P
P
u
u
m
m
p
p
e
e
n
n
a
a
u
u
s
s
g
g
a
a
n
n
g
g
(
(
m
m
e
e
c
c
h
h
a
a
n
n
i
i
s
s
c
c
h
h
e
e
L
L
e
e
i
i
s
s
t
t
u
u
n
n
g
g
)
)
K
K
v
v
K
K
m
m
1
1
K
K
m
m
2
2
K
K
m
m
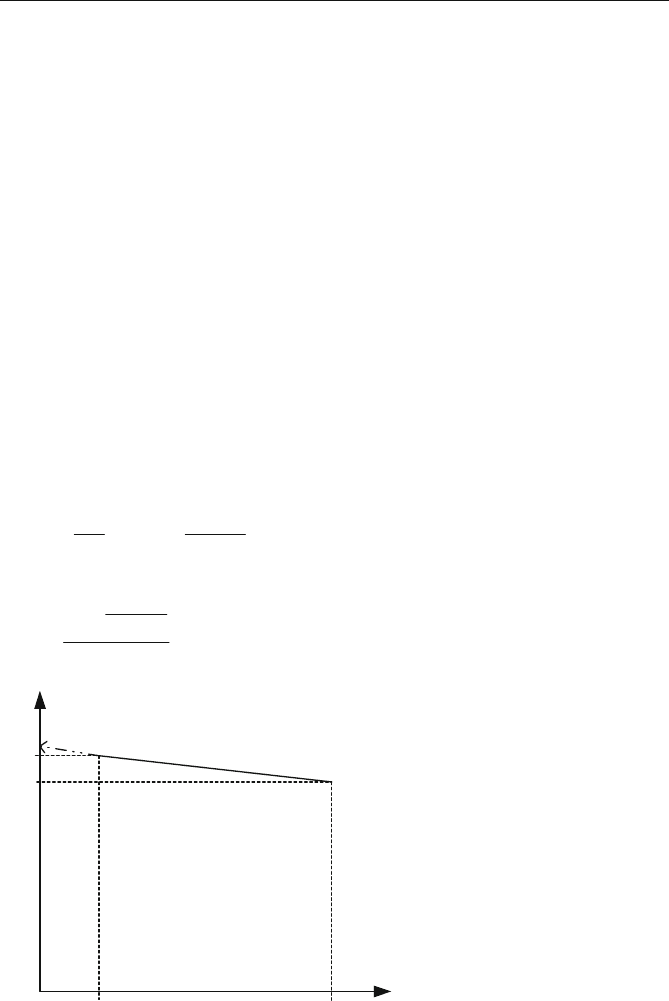
6.2 Kenngrößen 127
leitung gemessen. Sollte die direkte Messung von Q
La
nicht möglich sein, so kann
mit den Gln. (6.16) bzw. (6.17) unter Nutzung der erforderlichen Messwerte
(Drehzahl
n und abgegebener Volumenstrom der Pumpe Q
abP
) Q
L
berechnet wer-
den. Bei einer direkten Messung von
Q
La
muss beachtet werden, dass oft konstruk-
tiv bedingte Spülströme in die Leckleitung einmünden, so dass Ungenauigkeiten
auftreten können
abPthPLP
QQQ
(6.16)
thMzuLM
QQQ .
(6.17)
Sollte das Verdrängungsvolumen
V nicht bekannt sein, kann es rechnerisch bzw.
grafisch aus Messwerten gemäß Abb. 6.5 bestimmt werden. Bei Pumpen werden
zumindest zwei Förderströme
Q
1
und Q
2
bei p
1
und p
2
gemessen, die sich er-
gebende Gerade wird bis zum Schnittpunkt mit der
Q-Achse verlängert und daraus
das Verdrängungsvolumen bestimmt.
Der Sachverhalt kann auch mathematisch erfasst werden, indem aus den Mess-
werten mit Gl. (6.18) der allgemeine funktionelle Zusammenhang bestimmt wird.
Durch Einsetzen von
p = 0 in Gl. (6.18) ergibt sich aus (6.19) das gesuchte Ver-
drängungsvolumen
V.
p
Qp
Qp
p
Q
Q
'
'
'
'
1
1
mit
21
QQQ ' und
12
ppp ' (6.18)
n
p
Qp
Q
V
'
'
1
1
(6.19)
p
n = konst.
T = konst.
Q
Q
1
Q
2
p
1
p
2
Abb. 6.5 Kennlinie zur Bestimmung des Verdrängungsvolumens von Pumpen
