Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.

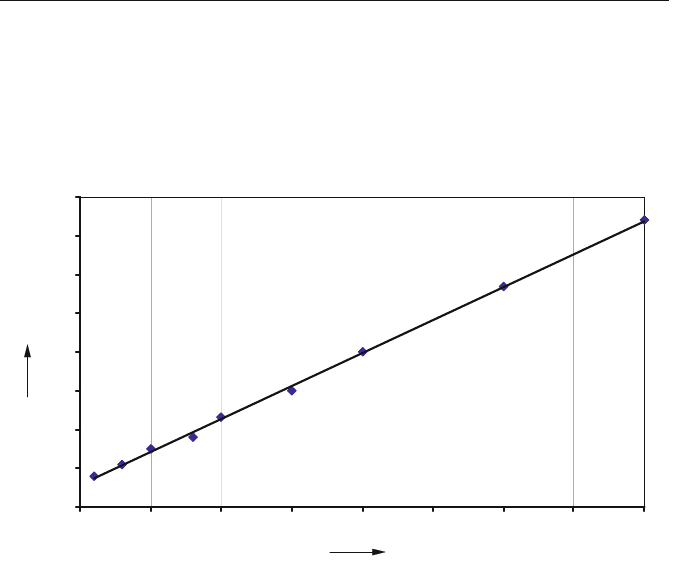
68 4 Berechnungsgrundlagen
Für einen ausgeführten Filter, bestehend aus Gehäuse und Filterelement (Filter-
feinheit 25
P
m und NG 32 mm) ergeben sich die Parameter der Widerstands-
charakteristik zu K1 = 12175 und K2 = 5,49.
Abb. 4.28 zeigt die Viskositätsabhängigkeit des Druckverlustes des unver-
schmutzten Filters bei einem Volumenstrom von Q = 50 l/min.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Q [mm
2
/s]
'
p
verl
[bar]
'
p
verl
= f(
Q
)
Abb. 4.28 Druckverlust-Viskositäts-Kennlinie eines Filters
Die Ausführungen des Abschn. 4.4.1 gelten exakt nur, wenn die Strömung
durch die Strömungswiderstände isotherm und stationär ist. Diese Voraus-
setzungen treffen in der Praxis nur angenähert zu. Durch die als Folge der Druck-
verluste entstehende Wärme ist die Fluidtemperatur längs des Strömungsweges
nicht konstant und die wirklichen Druckverluste werden geringfügig von den be-
rechneten Werten abweichen. Eine genaue Druckverlustberechnung ist mit
Methoden nach [4.15] möglich.
Da Pumpen einen pulsierenden Volumenstrom liefern (s. Kap. 6), dessen Amp-
litude von den Nachgiebigkeiten und Trägheitskräften der Anlage abhängt, werden
die Druckverluste von denen, die bei einem pulsationsfreien Volumenstrom auf-
treten, abweichen. Diese Druckverlusterhöhung ist bei normalen Hydraulik-
anlagen sehr gering. Sie kann näherungsweise berechnet werden [4.14, 4.16].
4.4.2 Leckverluste
Leckverluste sind Flüssigkeitsverluste, die von einer Druckdifferenz durch einen
als Leckstelle wirkenden Strömungswiderstand in Hydraulikanlagen, Komponen-
ten oder auch anderen Bauelementen verursacht werden. Die in Abb. 4.15 b dar-
gestellte spielbehaftete Paarung zwischen Kolben und Bohrung ist z. B. eine sehr

4.4 Strömungswiderstände 69
häufig vorkommende Leckstelle. Leckvolumenströme Q
L
sind Volumenstromver-
luste, die über eine Leckstelle nach außen (äußere Leckverluste) oder in Räume
mit niedrigerem Druck innerhalb hydraulischer Komponenten (innere Leckver-
luste) fließen.
Sie werden von der Volumenstromquelle gefördert, stehen aber nicht zur Be-
wegung der Hydromotoren (Arbeitszylinder oder Rotationsmotoren) zur Ver-
fügung. Das führt dazu, dass die Geschwindigkeit der Arbeitszylinder bzw. die
Drehzahl der Rotationsmotoren mit steigender Belastung abnehmen. Als Folge der
durch Leckvolumenströme verursachten Verringerung des Flüssigkeitsvolumens
in geschlossenen Räumen können mit aktiven Lasten beaufschlagte Hydromotoren
(s. Abschn. 5.5) im Stillstand ihre Position nicht einhalten. Die zur Beseitigung
dieses Mangels möglichen Maßnahmen werden in Kap. 8 und 14 behandelt.
Leckverluste sind Leistungsverluste. Sie verringern den Wirkungsgrad hydrau-
lischer Anlagen.
Innere Leckverluste sind nur an ihren Auswirkungen, wie Geschwindigkeits-
abfall, Wirkungsgradverringerung bzw. Funktionsstörungen (z. B. bei Schalt-
bewegungen von Ventilen) zu erkennen. Es ist zu sichern, dass innerer Leck-
volumenstrom zu Räumen niedrigeren Druckes abfließen kann.
Äußere Leckverluste verringern ebenfalls den Wirkungsgrad. Sie sind durch
geeignete Maßnahmen zum Behälter zurückzuführen, um Flüssigkeitsverluste in
den Hydraulikanlagen zu vermeiden und Umweltverschmutzung auszuschließen.
Äußere Leckverluste durch Risse in Bauelementen und undichte Verbindungen
von Leitungen und Bauelementen dürfen grundsätzlich nicht auftreten. Sie sind
durch Auswahl geeigneter Dichtelemente, Werkstoffe, sorgfältige Montage und
regelmäßige Wartung zu vermeiden.
Leckverluste durch funktionsbedingte Spalte zwischen relativ zueinander be-
wegten Bauteilen (z. B. zwischen Kolben und Gehäuse von Ventilen oder an Ver-
drängerelementen von Pumpen) sind unvermeidbar. Sie dienen gleichzeitig der
Schmierung dieser Bauteile. Der durch derartige Spalte fließende Leckvolumen-
strom Q
L
ist näherungsweise vorausberechenbar. Wegen der geringen Spalthöhe
(meist im Mikrometerbereich) und der relativ großen Spaltlänge ist die Strömung
in derartigen Leckstellen überwiegend laminar, und es kann mit dem hydrauli-
schen Linearwiderstand R
h
nach Gl. (4.63) gerechnet werden. Da bei der Be-
rechnung von Leckvolumenströmen der von einer vorgegebenen Druckdifferenz
'
p verursachte Leckvolumenstrom Q
L
zu ermitteln ist, wird zweckmäßigerweise
mit den Leitwerten G
h
der Widerstände nach Gl. (4.65) gearbeitet.
So kann der Einfluss des inneren und des äußeren Leckvolumenstromes eines
Arbeitszylinders mit Spiel zwischen Kolben und Zylinder sowie zwischen Kol-
benstange und Kolbenstangenführung (Abb. 4.29 a) auf die Kolbengeschwindig-
keit v und den Abflussstrom Q
2
mit Hilfe des in Abb. 4.29 b dargestellten Modells
berechnet werden.
Bei bekannter Belastung F, bekanntem Gegendruck p
2
, vorgegebenem Volu-
menstrom Q
1
und bekannten Leitwerten G
Li
und G
La
können mit Hilfe der Kräfte-
bilanz am Kolben und der Volumenstrombilanz an den Knoten des Modells der
Eingangsdruck p
1
, die Kolbengeschwindigkeit v sowie der Volumenstrom Q
2
zu
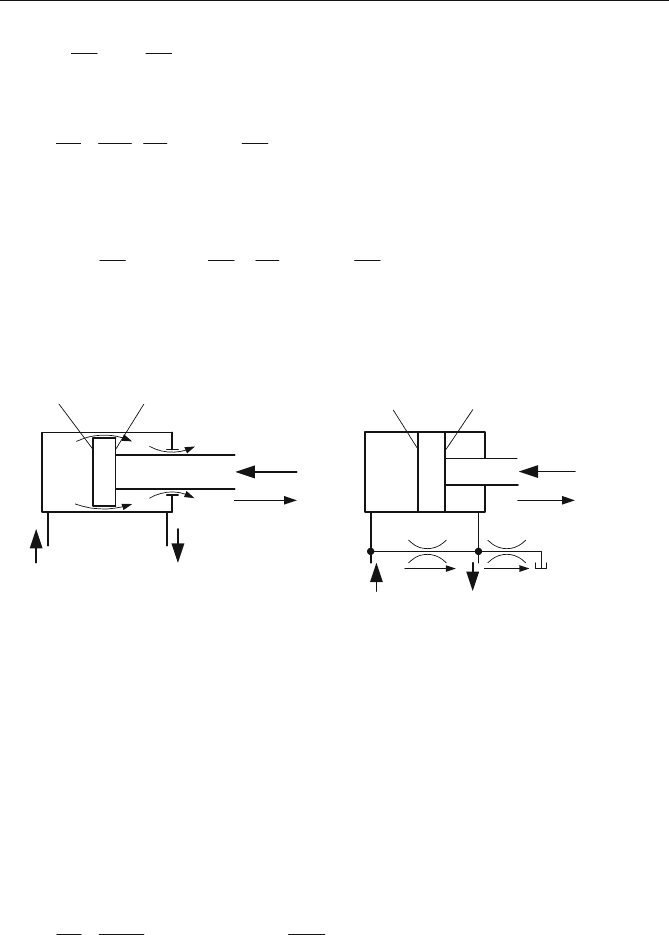
70 4 Berechnungsgrundlagen
p
F
A
p
A
A
1
1
2
2
1
, (4.74)
v
Q
A
G
A
F
A
p
A
A
Li
§
©
¨
·
¹
¸
ª
¬
«
«
º
¼
»
»
1
111
2
2
1
1 (4.75)
und
QQ
A
A
G
A
A
F
A
p
A
A
pG
Li La21
2
2
2
11
2
2
1
2
11
§
©
¨
·
¹
¸
§
©
¨
·
¹
¸
ª
¬
«
«
º
¼
»
»
(4.76)
berechnet werden.
Q
Li
Q
La
Q
1
Q
2
p
1
p
2
F
v
A
1
A
2
A
1
A
2
p
1
p
2
G
Li
G
La
Q
1
Q
2
Q
Li
Q
La
F
v
ab
Abb. 4.29 Leckvolumenstrom an einem Arbeitszylinder. a Darstellung mit spielbehaftetem
Kolben und Kolbenstange b Leckvolumenstrom-Modellierung
Für die Ermittlung des Einflusses von Leckverlusten auf das Bewegungs-
verhalten eines Hydromotors für drehende Abtriebsbewegung kann das Modell
nach Abb. 4.30 a verwendet werden.
Wegen des i. Allg. symmetrischen Aufbaus eines derartigen Motors können die
Leckleitwerte G
La1
und G
La2
gleichgesetzt werden
GGG
La La La12
. (4.77)
Damit wird die Abtriebsdrehzahl
n
Q
V
M
V
GG p
G
V
La Li
La
1
2
2
S
. (4.78)
Abb. 4.30 b zeigt die Abhängigkeit der Drehzahl n vom Lastmoment M und vom
Gegendruck p
2
.
Durch den äußeren Leckvolumenstrom Q
La
nimmt die Drehzahl auch bei un-
belastetem Motor (M = 0) mit zunehmendem Gegendruck p
2
ab.
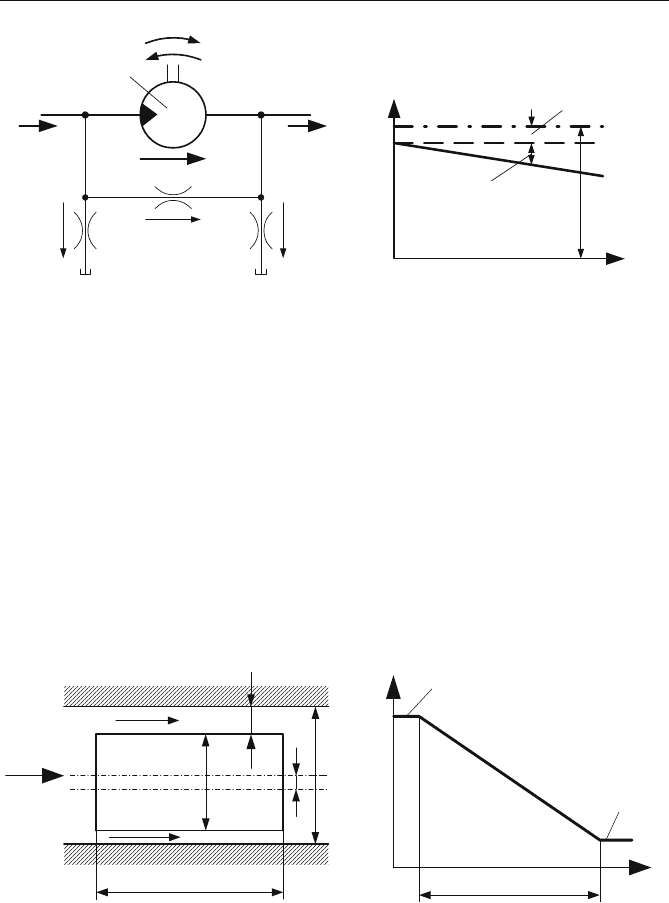
4.4 Strömungswiderstände 71
Q
1
/V = n
th
p
2
G
La
/V
M2S (G
La
+G
Li
)/V
2
n
M
b
M
n
Q
1
Q
2
p
1
p
2
Q
M
Q
Li
Q
La1
Q
La2
G
Li
G
La1
G
La2
V
a
Abb. 4.30 Leckvolumenstrom-Modellierung. a Modellierung eines Hydromotors mit Leck-
leitwerten b Abhängigkeit der Drehzahl n vom Drehmoment M und vom Druck p
2
Mit Hilfe der vorgestellten Modellierung von Hydromotoren ist es u. a. mög-
lich, das Betriebsverhalten bei Parallelbetrieb mehrerer Hydromotoren zu er-
mitteln [4.1] sowie Antriebe mit mehreren miteinander mechanisch gekoppelten
Motoren funktionssicher zu gestalten und zu optimieren. Es ist möglich, dass die
Motoren sowohl parallel als auch in Reihe geschaltet werden. Dabei können die in
Gln. (4.74) bis (4.78) verwendeten Leckleitwerte G
L
aus experimentellen Unter-
suchungen bzw. aus Angaben zu Leckverlusten in Firmenunterlagen gewonnen
werden. Für geometrisch eindeutig bestimmte Spalte kann der Leckvolumenstrom
Q
L
und damit der Leckleitwert G
L
auch theoretisch bestimmt werden.
Q
L
s
d
1
d
2
l
e
p
1
p
2
a
p
x
l
p
1
p
2
b
Abb. 4.31 Leckströmung bei exzentrischem Kolben. a Spaltabmessungen b Druckverlauf
im Spalt
Für einen exzentrischen Ringspalt nach Abb. 4.31 mit s
d
1
bzw. d
2
kann un-
ter Vernachlässigung der Eintritts- und Austrittsverluste nach [4.17] mit für die
Praxis ausreichender Genauigkeit Q
L
zu
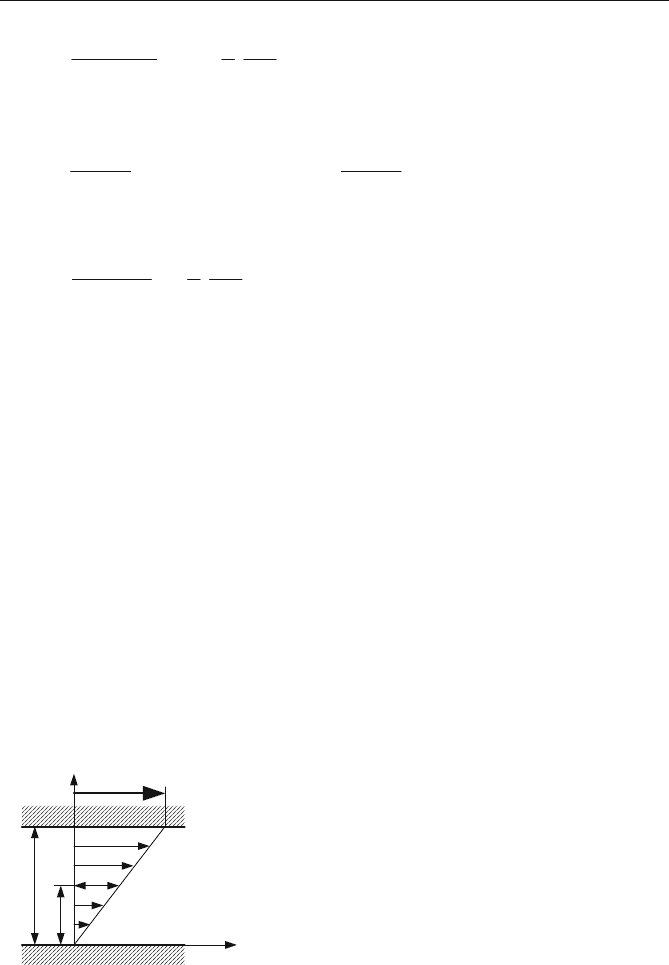
72 4 Berechnungsgrundlagen
Q
ds
l
p
e
s
L
mm
m
§
©
¨
¨
·
¹
¸
¸
S
QU
3
2
2
12
1
3
2
' (4.79)
mit
d
dd
dd
m
||
12
12
2
und s
dd
m
12
2
ermittelt werden. Der Leckleitwert G
L
für Ringspalte beträgt
G
ds
l
e
s
L
mm
m
§
©
¨
¨
·
¹
¸
¸
S
QU
3
2
2
12
1
3
2
. (4.80)
Die Größe s des Ringspaltes geht mit der dritten Potenz in die Gleichung für Q
L
ein. Eine Spaltverdoppelung führt also zu einer Verachtfachung des Leck-
volumenstromes. Eine exzentrische Verlagerung des Kolbens, die in der Praxis
häufig vorkommen kann, führt zu einer Vergrößerung von Q
L
um den Faktor 2,5.
Bei der in die Gl. (4.80) einzusetzenden Viskosität ist zu beachten, dass wegen der
großen Druckdifferenz über dem Leckspalt längs des Spaltes große Temperatur-
unterschiede auftreten können. Deshalb ist es ratsam, das arithmetische Mittel der
Viskositäten an Spalteingang und -ausgang zu verwenden.
Trotz guter Filterung können Schmutzpartikel in den Spalt, der in den meisten
Fällen nur wenige Mikrometer beträgt, eindringen und die wirksame Spaltfläche
verringern. Das führt zu einer Abnahme des Leckvolumenstromes. Dieser Vor-
gang ist zeitabhängig und kann, wenn keine Relativbewegung zwischen Kolben
und Bohrung auftritt, zum völligen Zusetzen einer Leckstelle führen.
Bei einer Relativbewegung zwischen den die Leckstelle bildenden Wänden tritt
zusätzlich eine Schleppströmung auf, wodurch der durch die Druckdifferenz ver-
ursachte Leckvolumenstrom vergrößert oder verkleinert wird, je nachdem, ob die
Bewegung in Richtung der Druckdifferenz oder entgegengesetzt erfolgt.
x
y
v
s
x
y
Abb. 4.32 Schleppströmung zwischen parallelen, relativ zueinander bewegten Platten
In Abb. 4.32 ist die Geschwindigkeitsverteilung in einem Parallelspalt mit der
Breite b dargestellt, dessen Wände sich zueinander mit der Geschwindigkeit v be-
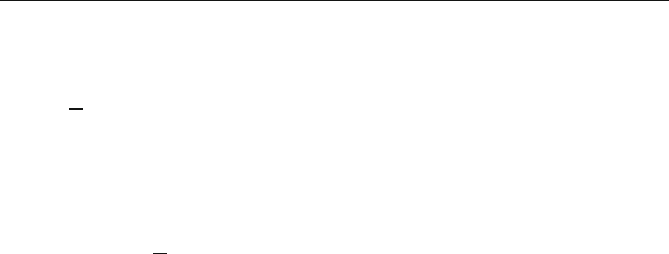
4.5 Hydraulische Kapazität und Induktivität 73
wegen. Für den durch die Bewegung der Spaltwände erzeugten Volumenstrom Q
s
gilt
Q
v
sb
s
2
. (4.81)
Der gesamte Leckvolumenstrom eines bewegten Kolbens wird damit in Ab-
hängigkeit von der Bewegungsrichtung des Kolbens und der Richtung der Druck-
differenz
QGp
v
sd
Lges m m
r '
2
S
. (4.82)
4.5 Hydraulische Kapazität und Induktivität
Die bisherigen Betrachtungen im Kap. 4 gelten nur für stationäre Strömungsvor-
gänge. Dabei wird vorausgesetzt, dass Drücke und Volumenströme sowie die zu
überwindenden Lasten keine zeitliche Änderung erfahren. Bei Berechnungen für
stationäre Strömungsvorgänge genügt die Berücksichtigung der Druckverluste
durch den Widerstand R
h
und der Leckverluste durch den Leitwert G
h
.
In der Praxis treten jedoch zeitliche Veränderungen von Druck, Volumenstrom
und Lasten auf. Dies ist u. a. der Fall bei Anlauf- und Bremsvorgängen, bei der
Änderung von Bewegungszuständen durch Schalten von Ventilen sowie bei Last-
änderungen. Dabei können kritische Betriebszustände, wie Druckspitzen und Dau-
erschwingungen, auftreten. Um das Betriebsverhalten hydraulischer Anlagen in
derartigen Fällen ermitteln zu können, muss sowohl die Speicherung potenzieller
Energie, durch die Kompressibilität des Fluids, die Aufweitung von Leitungen
sowie in Druckflüssigkeitsspeichern, berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist es
erforderlich, die Speicherung kinetischer Energie durch die Trägheit des bewegten
Fluids und der Hydromotoren sowie der bewegten Massen zu berücksichtigen.
Werden die in Abschn. 4.4.1 eingeführten Widerstände R
h
und R’
h,
, welche E-
nergieverluste verursachen, als Widerstände gegen Bewegung [4.18] angesehen,
so sind die dynamischen Widerstände gegen Verformung und gegen Be-
schleunigung Energiespeicher, in denen keine Verluste auftreten. Sie können als
kapazitive und induktive Widerstände betrachtet werden.
Hydraulische Kapazität
Wird ein Fluidvolumen V durch einen Druck p beaufschlagt, so entsteht wegen
seiner Kompressibilität (s. Abschn. 3.3.2) eine Volumenverringerung V
c
(Abb.
4.33 a). Die in Abb. 4.33 b dargestellte Funktion V
c
= f(p) ist nichtlinear. Es gilt
dV C dp
ch
. (4.83)
C
h
ist die hydraulische Kapazität. Sie nimmt mit zunehmendem Druck p ab. In
vielen Fällen genügt die Linearisierung um einen Arbeitspunkt p
A
. Für den Kom-
pressionsvolumenstrom Q
c
und den Druck p gelten die Beziehungen
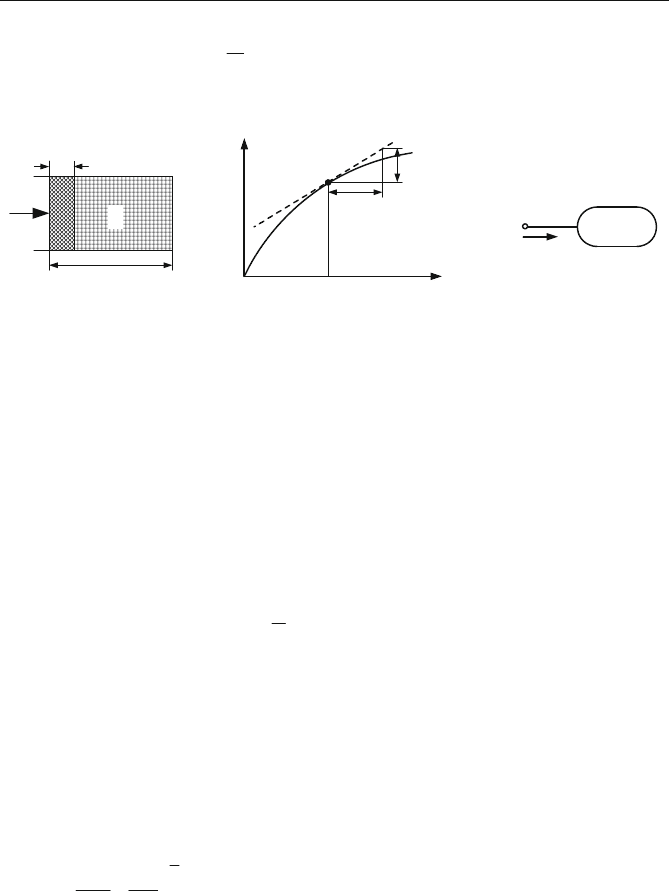
74 4 Berechnungsgrundlagen
QVCp
cc h
und p
C
Qdt
h
c
³
1
. (4.84)
V
V
c
p
E
p
V
c
p
A
dp
dV
c
V
c
= f(p)
Q
c
C
h
p, p
.
ab c
Abb. 4.33 Hydraulische Kapazität. a Kompressionsvorgang b Abhängigkeit des Kompres-
sionsvolumens vom Druck c Schaltsymbol einer hydraulischen Kapazität
Eine hydraulische Kapazität kann durch das Symbol nach Abb. 4.33 c dargestellt
werden. In einer Hydraulikanlage wird das Kompressionsvolumen V
c
nicht nur
durch das Fluid, sondern auch durch Leitungsaufweitungen und bei Anlagen mit
Druckflüssigkeitsspeicher durch dessen Speichervolumen bestimmt. Damit gilt
CCCC
ges Fl Ltg Sp
. (4.85)
C
Fl
erhält man aus der Pressziffer
E
bzw. dem Kompressionsmodul K des Fluids
(s. Abschn. 3.3.2) zu
CV
Fl o
E
bzw. CV
k
Fl o
1
. (4.86)
Da in Hydraulikanlagen häufig freie Luft vorhanden ist, wird die hydraulische
Kapazität C
Fl
meist größer als die von luftfreier Flüssigkeit sein (s. Abschn. 3.3.3).
Während die Nachgiebigkeit von Rohrleitungen praktisch vernachlässigbar ist,
muss die hydraulische Kapazität C
Ltg
von Schlauchleitungen in den meisten Fällen
berücksichtigt werden. Werte für C
Ltg
sind aus Firmenunterlagen oder durch Ver-
suche zu gewinnen.
Für die hydraulische Kapazität von gasbelasteten Druckflüssigkeitsspeichern
gilt [4.19]
C
V
np
p
p
Sp
G
n
§
©
¨
·
¹
¸
1
1
(4.87)
mit
p
G
Gasfülldruck
p Flüssigkeitsdruck | Gasdruck
V
1
Speichergröße
n Polytropenexponent (Isotherme Zustandsänderung n = 1, isentrope Zustands-
änderung n = 1,4).
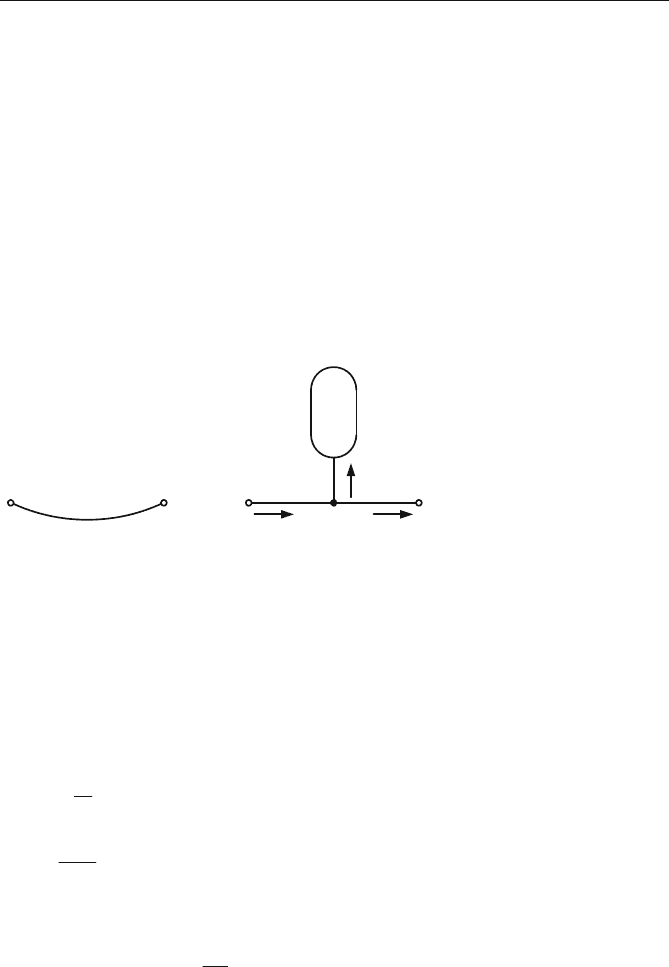
4.5 Hydraulische Kapazität und Induktivität 75
Der Polytropenexponent n liegt in der Praxis (s. Abschn. 9.4) zwischen beiden
Grenzwerten. Bei dynamischen Vorgängen kann mit n
|
1,4 gerechnet werden.
Weiterhin muss beachtet werden, dass ein Druckflüssigkeitsspeicher nur bei Drü-
cken p
!
p
G
Fluidvolumen
aufnehmen bzw. abgeben kann. Bei dynamischen Vor-
gängen sollte deshalb der Minimalwert des Druckes p
min
den Gasfülldruck nicht
unterschreiten.
Abb. 4.34 zeigt die Modellierung einer Schlauchleitung mit dem in der Abb.
4.33 c gezeigten Symbol einer hydraulischen Kapazität. Für den Volumenstrom
Q
2
gilt in diesem Falle
QQC p
ges21
. (4.88)
Die Druckverluste der Schlauchleitung wurden in diesem Beispiel vernachlässigt.
=
C
ges
Q
1
Q
2
Q
c
p, p
.
Abb. 4.34 Modellierung der hydraulischen Kapazität einer Schlauchleitung
Hydraulische Induktivität
Bei einer zeitlichen Änderung des Volumenstromes muss die Masse des strömen-
den Fluids beschleunigt oder verzögert werden. Für die Beschleunigung der in
Abb. 4.35 a dargestellten Fluidmasse m =
U
V ist die erforderliche Kraft
pA Vs
U
. (4.89)
Mit
s
Q
A
wird der zur Beschleunigung erforderliche Druck
p
V
A
Q
U
2
. (4.90)
Die Größe V
U
/ A
2
wird als hydraulische Induktivität L
h
bezeichnet. Es gilt
pLQ
h
und Q
L
pdt
h
³
1
. (4.91)
Für die zeichnerische Darstellung des durch die hydraulische Induktivität ver-
ursachten Widerstandes gegen Beschleunigung kann das in Abb. 4.35 b gezeigte
Symbol verwendet werden.
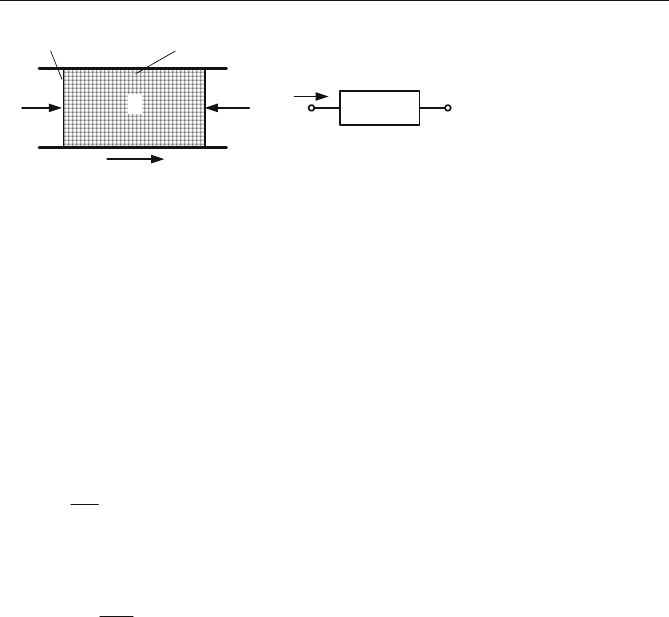
76 4 Berechnungsgrundlagen
V
A
s, s, s
p A
m s
.
.
..
.
..
U
L
Q, Q
p
.
a
b
Abb. 4.35 Hydraulische Induktivität. a Kräftegleichgewicht an einem beschleunigten Vo-
lumenelement b Schaltsymbol einer hydraulischen Induktivität
Für Hydromotoren (Arbeitszylinder bzw. Rotationsmotoren) und die trägen
Massen bzw. Trägheitsmomente der zu bewegenden Baugruppen und Anlagen-
teile hydraulisch angetriebener Maschinen kann ebenfalls eine Induktivität defi-
niert werden. Dabei ist es zweckmäßig, die gesamte translatorisch zu bewegende
Masse auf die Kolbenstange des Arbeitszylinders und das gesamte Trägheits-
moment der rotierenden Bauteile und Maschinenelemente auf die Abtriebswelle
des hydraulischen Rotationsmotors zu reduzieren.
Für diese Induktivitäten gilt
L
m
A
tr
2
bei translatorischen Antrieben (4.92)
und
LI
V
rot
M
§
©
¨
·
¹
¸
2
2
S
bei rotatorischen Antrieben. (4.93)
In den Gln. (4.92) und (4.93) bedeuten
m Masse der bewegten Bauteile einschließlich des Arbeitskolbens
A Kolbenfläche
I Trägheitsmoment der rotierenden Bauteile einschließlich des Hydromotors
V
M
Verdrängungsvolumen des Hydromotors.
Durch den Vorteil der hohen Kraftdichte der Hydraulik sind die von Hydro-
motoren erzeugten Kräfte bzw. Drehmomente im Vergleich zu anderen Antriebs-
arten in den meisten Fällen sehr groß. Dadurch wird es möglich, die anzu-
treibenden Baugruppen hydraulischer Maschinen und Anlagen direkt an die
Kolbenstange bzw. an die Motorwelle anzukoppeln. Diese Besonderheit
hydraulischer gegenüber z. B. elektrischer Antriebe führt dazu, dass die Induktivi-
täten L
tr
und L
rot
meist wesentlich größer sind als die hydraulische Induktivität L
h
des zu beschleunigenden Fluids. In diesen Fällen kann L
h
bei der Behandlung
dynamischer Vorgänge vernachlässigt werden.
Für die Ermittlung des dynamischen Verhaltens von Leitungssystemen sind ge-
sonderte Leitungsmodelle mit Kombinationen von hydraulischen Widerständen R,
Kapazitäten C
h
und Induktivitäten L
h
erforderlich [4.16].
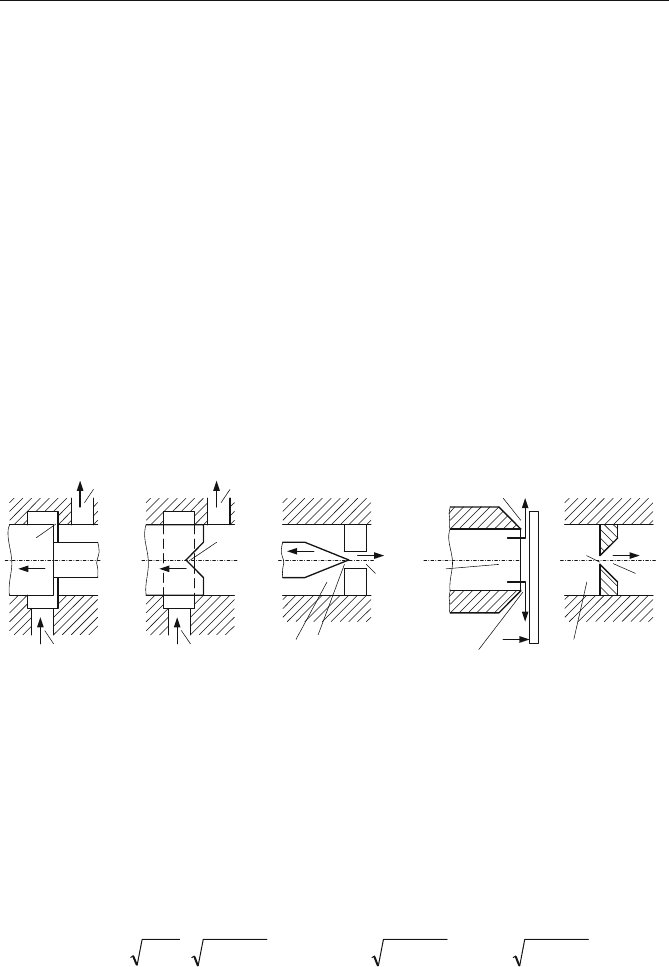
4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen 77
4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen
Die Zusammenschaltung von Strömungswiderständen dient vor allem der stetigen
Steuerung von Verbraucherbewegungen oder von Steuerelementbewegungen in
Komponenten, die sehr große Leistungen beeinflussen müssen. Diese Widerstände
zur Steuerung von Druck und Volumenstrom werden vor allem in Ventilen ver-
wendet und müssen bestimmte Eigenschaften besitzen:
Zumindest ein Teil von ihnen muss auf eine einfache und mit geringen Stell-
kräften realisierbare Art einstellbar sein.
Die Größe des Widerstandes soll nahezu unabhängig von der Viskosität des
Fluids sein.
Die Widerstände sollen nicht zur Verschmutzung neigen.
In Abb. 4.36 sind typische konstruktive Formen dieser Widerstände, die in Abb.
4.36 a bis d durch axiale Verschiebung von Kolbenlängsschieber, Kegel oder
Prallplatte eingestellt werden können, dargestellt.
s
Q
Q
p
1
p
2
R
h
s
Q
p
1
p
2
R
h
s
Q
Q
p
1
R
h
p
2
Q
p
1
p
2
R
h
s
Q
p
1
p
2
R
h
a b c d e
Abb. 4.36 Konstruktive Ausbildung typischer Drosselstellen (Widerstände) zur stetigen
Steuerung (in a bis e Steuerspalte). a Kolbenlängsschieber b Kolbenlängsschieber mit Pro-
filkante c Kegeldrossel d Düse-Prallplatte e Blende (nicht einstellbar)
Der Durchflussbeiwert
D
derartiger Drosselstellen mit schroffen Querschnitts-
änderungen ist in dem interessierenden Volumenstrombereich praktisch un-
abhängig von der Reynoldszahl Re. Damit kann in guter Näherung Gl. (4.70) mit
D
| konst. für die Berechnungen angewendet werden:
212121
/2 ppGppAkppAQ
DrDrDrDr
|
UD
.
(4.94)
Der Drosselquerschnitt A
Dr
ist der engste Querschnitt, durch den das Fluid treten
muss, er ist in Abb. 4.36 der Strömungswiderstand R
h
(in Berechnungen ist es oft
günstiger, vom Leitwert G
Dr
nach Gl. (4.94) auszugehen). In Abb. 4.36 a hat der
Drosselquerschnitt näherungsweise (Radialspiel vernachlässigt) die Form eines
