Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.


78 4 Berechnungsgrundlagen
Zylindermantels; seine Fläche ist Kolbenschieberumfang mal Spaltlänge (die sich
proportional mit der Verschiebung s ändert). Die weiteren Querschnittsflächen in
Abb. 14.36 b bis e sind näherungsweise Dreieckfläche, Kegelstumpfmantel, Zy-
lindermantel und Kreisfläche.
Der Durchflussbeiwert
D
liegt, abhängig von der Konstruktion der Drossel-
stelle, im Bereich 0,6 <
D
< 1. Sind die Übergangszonen zwischen den großen und
kleinen Querschnitten sehr kurz, z. B. an einer Blende (s. Abb. 4.36 e), strebt
D
gegen 0,6, bei relativ langen Übergangszonen (s. Abb. 4.36 c) gegen eins. Das Zu-
setzen der meist sehr engen Drosselstellen muss teilweise durch spezielle Filter
vor den entsprechenden Bauelementen verhindert werden. Die Wirbel der Strö-
mung an den durch den Drosselquerschnitt A
Dr
gegebenen engsten Querschnitten
haben den Vorteil, dass sich keine Harze und ähnliche Verschmutzungen ablagern
können.
In der Hydraulik gibt es Komponenten, die nur einen Steuerspalt enthalten,
z. B. Drosselventile oder Druckventile (s. Kap. 8; innerer Aufbau meist nach Abb.
4.36 b). Die Steuerfunktion der Widerstände erfordert in vielen Fällen aber den
Aufbau von Schaltungen aus zwei Strömungswiderständen, meist in Druckteiler-
schaltung (z. B. in Zwei-Wege-Stromregelventilen, s. Kap. 8), oft auch von Brü-
ckenschaltungen aus vier Strömungswiderständen (z. B. in Servoventilen, s.
Kap. 8). Schwierig für die Berechnung des Verhaltens dieser Schaltungen ist, dass
zum einen nichtlineare Beziehungen gemäß Gl. (4.94) zugrunde gelegt werden
müssen und zum anderen diese Schaltungen durch nicht zu vernachlässigende Vo-
lumenströme belastet werden. Die zum Teil recht aufwendige Herleitung am Ende
teilweise linearisierbarer Beziehungen soll am Beispiel eines Kolbenlängsschie-
berventils mit Vierkantensteuerung gezeigt werden, wie es in Stetigsteuerventilen
anzutreffen ist (s. Abb. 4.37). Sowohl im Konstruktionsschema (Abb. 4.37 a) als
auch in der Widerstandsdarstellung (Abb. 4.37 b) ist angegeben, welche Strö-
mungswiderstände sich mit wachsendem s verringern und welche sich vergrößern.
In Mittelstellung des Kolbenschiebers haben alle vier veränderbaren Steuerspalte
eine endlich große Spaltbreite s
0
. Mit der Auslenkung s werden zwei Spalte klei-
ner (für s t s
0
wird ihre Spaltbreite null) und zwei größer. Das Belastungsglied
dieser Brückenschaltung wird allgemein mit Verbraucher bezeichnet. Es kann sich
dabei um einen Hydromotor, aber auch um einen weiteren steuerbaren Widerstand
oder den Kolbenschieber einer weiteren Verstärkerstufe handeln.
Für den Verbraucher ist ein eindeutiger funktioneller Zusammenhang
Q
V
= f(
'
p) mit
'
p = p
1
– p
2
allgemein nicht anzugeben. Für die Brückenschaltung
ist es deshalb zweckmäßig, den mathematischen Zusammenhang zwischen Steuer-
schieberweg s und Druckdifferenz
'
p in Abhängigkeit des im Brückendiagonal-
zweig entnommenen Volumenstromes Q
V
allgemein darzustellen. Die Breite der
Steuerspalte wurde sehr viel größer gezeichnet als sie in Wirklichkeit ist, um das
Wirkungsprinzip besser erkennen zu können (s
0
meist kleiner als 0,1 mm). Die
Spalte sollen in der gezeichneten Stellung des Steuerschiebers (s = 0) die Spalt-
breite s
0
haben (vollständige Symmetrie des Ventils). Es wird zunächst nur einer
dieser Spalte betrachtet. Durch den linken Spalt fließt der Volumenstrom Q
1
bei
einem Druckabfall p
1
und der allgemeinen Spaltbreite s
0
- s.
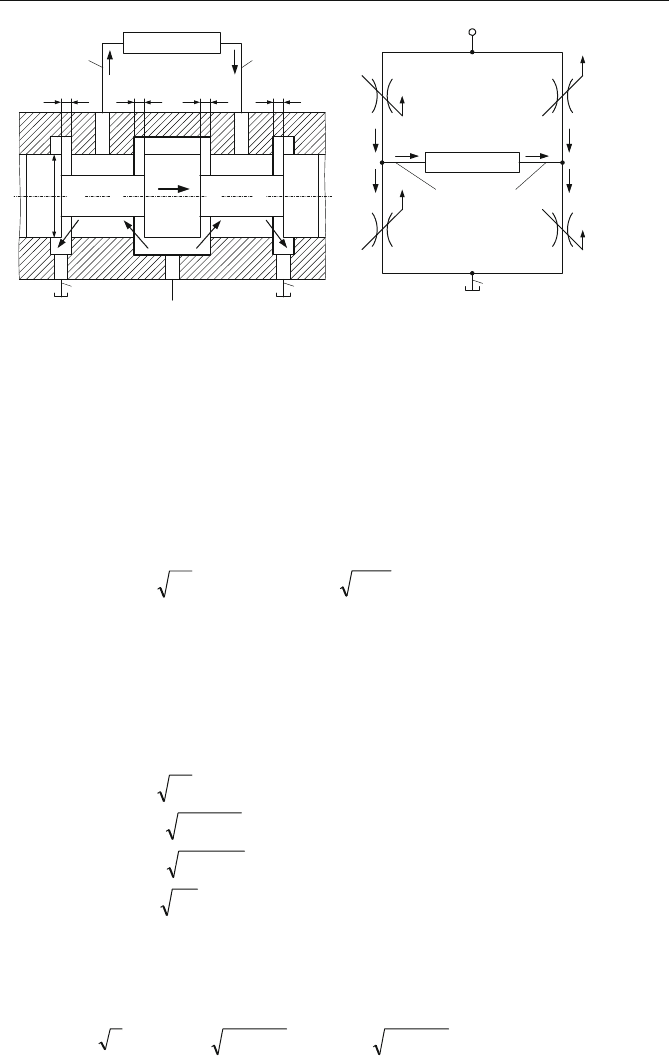
4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen 79
a
Verbraucher
s
0
-ss
0
-s s
0
+s s
0
+s
s
p
2
p
1
Q
V
Q
V
Q
1
Q
01
Q
2
Q
02
p
0
p
=
0 p
=
0
d
b
Verbraucher
Q
1
Q
01
p
0
p
=
0
Q
2
Q
02
Q
V
Q
V
p
2
p
1
s
s
s
s
Abb. 4.37 Vierkantensteuerung mit Kolbenlängsschieber. a Konstruktionsschema b Brü-
ckenschaltung in Widerstandsdarstellung
Unter Vernachlässigung von Radialspiel, Kantenrundung usw. ist die Drossel-
fläche A
Dr
(Mantelfläche des Zylinders)
)(
0
ssdA
Dr
S
.
(4.95)
Die Berechnung der Abhängigkeiten in diesem Spalt wird mit Hilfe der Gl. (4.94)
vorgenommen. Es ist
101
)( pssYQ mit
USD
/2 dY .
(4.96)
Sowohl Druckabfall als auch Spaltbreite haben Einfluss auf den Volumenstrom.
Das ist typisch für alle derartigen Steuerprinzipien. Wesentlich ist für die weitere
mathematische Behandlung, dass Q
1
für s t s
0
, unabhängig von p
1
, zu null wird,
da der Drosselspalt dann (bei vernachlässigtem Radialspiel) geschlossen ist.
Für die Vierkantensteuerung ergibt sich aus Abb. 4.37 a und b folgendes Glei-
chungssystem:
101
)( pssYQ
10001
)( ppssYQ
20002
)( ppssYQ
202
)( pssYQ
022101
QQQQQ
V
.
(4.97)
Für den Volumenstrom Q
V
zum Verbraucher ergibt sich nach entsprechender Um-
rechnung:
>
@
ppssppssYQ
V
''
0000
)()()2/(
mit
21
ppp '
.
(4.98)
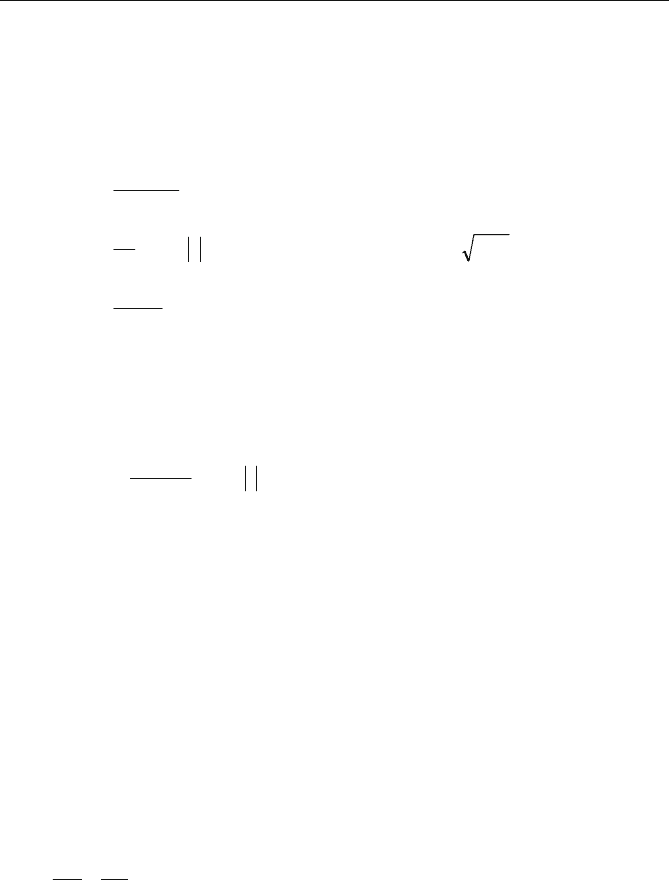
80 4 Berechnungsgrundlagen
Gleichung (4.98) gilt nur im Bereich _s_d s
0
. Für s > s
0
wird der zweite Term der
rechten Seite der Gleichung null, für s < -s
0
der erste Term. Die Grenzfälle der
Einsatzbedingungen eines solchen Steuerventils sind Kurzschluss (
'
p = 0) und
Leerlauf (Q
V
= 0) am Ventilausgang. Sie sind aus Gl. (4.98) abzuleiten. Für Kurz-
schluss gilt:
°
°
°
°
¯
°
°
°
°
®
!
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
ssfür
s
ss
ssfür
s
s
ssfür
s
ss
QQ
V
mit
000
2 psYQ .
(4.99)
Q
0
ist der Verlustvolumenstrom dieser Brückenschaltung bei Q
V
= 0 und s = 0.
Für Leerlauf gilt:
°
°
¯
°
°
®
!
d
'
0
0
22
0
0
0
0
1
2
1
ssfür
ssfür
ss
ss
ssfür
pp
.
(4.100)
In Abb. 4.38 sind die Abhängigkeiten der Druckdifferenz
'
p und des Volumen-
stromes Q
V
von der Auslenkung des Kolbens in normierter Form dargestellt. In
der Umgebung des Koordinatenursprungs sind die Kurven ohne großen Fehler li-
nearisierbar. Die Anstiege sind die Stromverstärkung C
0
und die Druckver-
stärkung E
0
(s. Abb. 4.38 b). Die Parameter C
0
und E
0
sind Maße für die Empfind-
lichkeit eines Steuerventils; ihre Größe steigt mit dem Versorgungsdruck p
0
. Die
Basisspaltbreite s
0
ist zur Erzielung hoher Druckverstärkung E
0
aber nicht beliebig
klein zu wählen, da dann die vernachlässigten Größen wie Kantenrundungen u. a.
wesentlichen Einfluss auf A
Dr
= f(s) gewinnen.
Bei Übergang auf endliche Größen von s, Q
V
,
'
p entsteht die in der Umgebung
des Koordinatenursprungs allgemein verwendete linearisierte Beziehung für Steu-
erventile mit stetigem Eingangssignal:
00
E
p
C
Q
s
V
'
.
C
0
Stromverstärkung
E
0
Druckverstärkung
(4.101)
Die Verschiebung s ist immer Eingangsgröße. Ausgangsgröße können entweder
Q
V
oder
'
p sein.
Es ist zu beachten, dass sich für C
0
und E
0
in einem beliebigen Arbeitspunkt
andere Ausdrücke gegenüber denen in Abb. 4.38 b ergeben. Diese sind durch Li-
nearisierung der Gl. (4.98) im jeweiligen Arbeitspunkt zu gewinnen. Im be-
rechneten Beispiel waren alle Steuerspalte bei s = 0 geöffnet (s
0
> 0, sog. negative
Überdeckung).
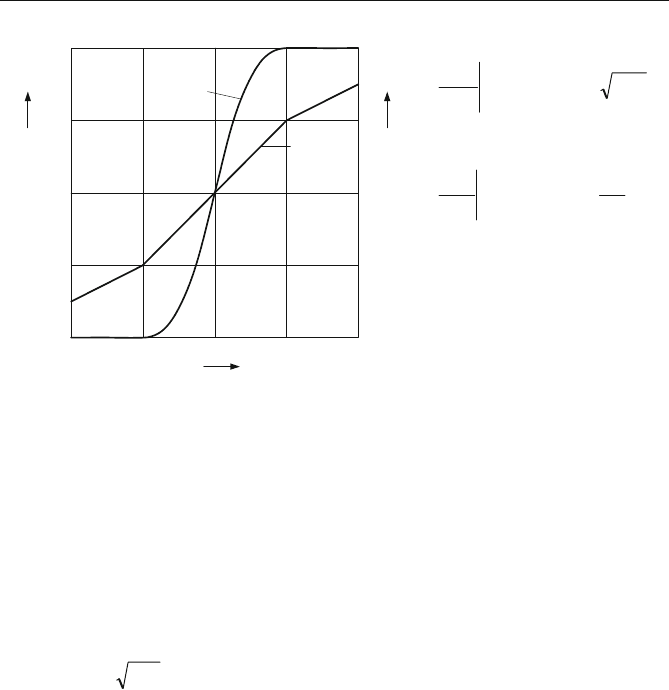
4.6 Verknüpfung von Strömungswiderständen 81
a
'
p/p
0
1,0
-1,0
-0,5
0
0,5
-2 2-1 10
'
p/p
0
-2
2
-1
1
0
Q
V
/Q
0
Q
V
/Q
0
s/s
0
Stromverstärkung C
0
:
00
0
2 pYC
ds
dQ
p
V
'
Druckverstärkung E
0
:
0
0
0
0
2
s
p
E
ds
pd
V
Q
'
b
Abb. 4.38 Vierkantensteuerung mit Kolbenlängsschieber. a Kurzschluss- und Leerlauf-
kennlinie b Strom- und Druckverstärkung C
0
, E
0
am Arbeitspunkt s = 0
Im Fall positiver Überdeckung (s
0
< 0, alle Steuerspalte in Mittelstellung s = 0
sind geschlossen) ist eine Linearisierung an der Stelle s = 0 nicht mehr zulässig. In
Tabelle 4.3 sind weitere häufig verwendete Widerstandskombinationen an-
gegeben, deren Berechnung auf gleiche Weise erfolgt. Alle veränderlichen Steuer-
spalte werden wie in Gl. (4.97) beschrieben. Die unveränderlichen Drosselstellen
werden über Y s
0
an diese Beschreibung angepasst (sie werden in den Ab-
bildungen der Tabelle durch das Schaltsymbol für ein Drosselventil dargestellt):
ii
psYQ '
0
.
(4.97*)
Neben dem Schaltungsprinzip sind die Leerlauffunktion und die lineare Gleichung
mit ihren Parametern E
0
und C
0
im Arbeitspunkt Q
V
= 0, s = 0 angegeben.
Die Leerlaufkennlinien sind, wiederum in normierter Form, in Abb. 4.39 für die
drei Fälle aus Tabelle 4.3 dargestellt. Im Vergleich zur Leerlaufkennlinie in
Abb. 4.38 sind die Anstiege in den typischen Arbeitspunkten kleiner. Ursache ist
die geringere Anzahl veränderbarer Drosselstellen. Die ermittelten Modelle und
Kennwerte spielen bei der Behandlung von Ventilen in Kap. 8 eine Rolle.
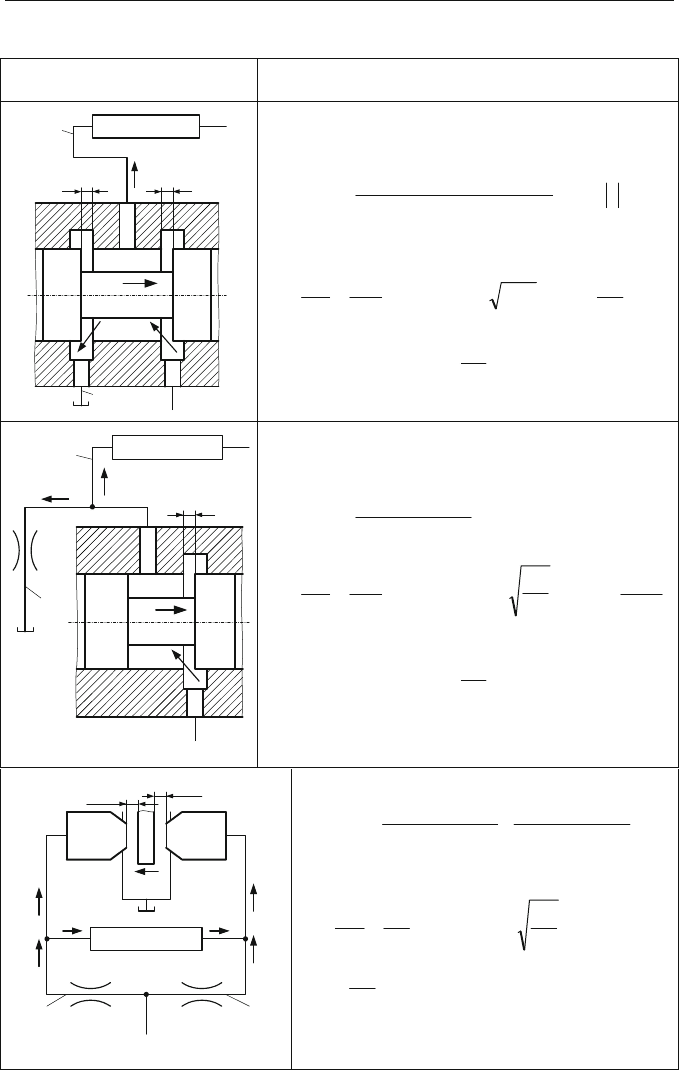
82 4 Berechnungsgrundlagen
Tabelle 4.3 Widerstandskombinationen zur Steuerung von Druck und Volumenstrom
Schaltung Leerlauffunktion und lineare Gleichung im Ar-
beitspunkt Q
V
= 0, s = 0
Verbraucher
s
0
-s s
0
+s
s
p
1
Q
V
Q
1
Q
01
p
0
p = 0
Zweikantensteuerung (Druckteiler):
°
°
¯
°
°
®
!
d
0
0
2
0
2
0
2
0
0
01
1
)/1()/1(
)/1(
0
ssfür
ssfür
ssss
ss
ssfür
pp
0
1
0
E
p
C
Q
s
V
'
mit
00
2 pYC ,
0
0
0
s
p
E
und
1
0
1
2
p
p
p '
Verbraucher
s
0
+s
s
p
1
Q
V
Q
1
Q
01
p
0
p = 0
Einkantensteuerung (Druckteiler):
°
¯
°
®
t
0
2
0
2
0
0
01
)/1(1
)/1(
0
ssfür
ss
ss
ssfür
pp
0
1
0
E
p
C
Q
s
V
'
mit
2
0
0
p
YC
,
0
0
0
2 s
p
E
und
1
0
1
2
p
p
p '
Verbraucher
s
p
1
Q
V
Q
1
Q
01
p
0
s
0
-s
s
0
+s
Q
2
Q
02
Q
V
p
2
Doppeldüse-Prallplatte (Brückenschaltung):
2
0
2
0
0
)/1(1
1
)/1(1
1
ssss
pp
'
(Aussteuerung auf -s
0
d s d s
0
begrenzt)
00
E
p
C
Q
s
V
'
mit
2
0
0
p
YC
und
0
0
0
s
p
E
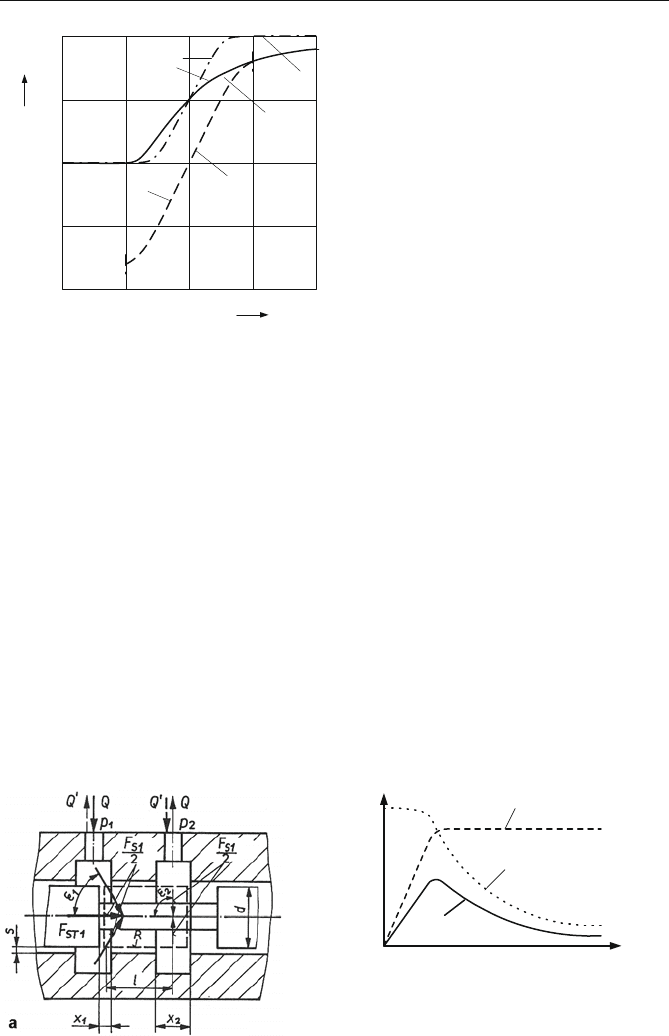
4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer Ventile 83
p
1
/p
0
1,0
0
0,5
-2 2-1 10
s/s
0
-1,0
-0,5
p
1
/p
0
'
p/p
0
'
p/p
0
Zweikantensteuerung
Einkantensteuerung
Doppeldüse-
Prallplatte
Abb. 4.39 Leerlaufkennlinien eines Druckteilers mit Zweikantensteuerung, mit Einkanten-
steuerung und einer Brückenschaltung mit Doppeldüse-Prallplatte-Einheit
4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer
Ventile
Hydraulische Ventile werden überwiegend in Kolbenlängsschieberbauart aus-
geführt (s. Kap. 8). Auf die Kolben der Druck-, Strom-, Wege- und Servoventile
wirken im Betrieb strömungsbedingte Radial- und Axialkräfte, welche enormen
Einfluss auf die Schalt- bzw. Stellkraft und damit auf das statische und dynami-
sche Betriebsverhalten der Ventile haben. Nachfolgend werden die wesentlichsten
dieser Kräfte behandelt, und es werden Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung auf-
gezeigt.
Strahlkräfte. Die Kraft, die ein Flüssigkeitsstrahl beim Auftreffen auf einen
Körper verursacht, kann mit Hilfe des Impulssatzes (s. Abschn. 4.3) berechnet
werden.
Q
Q
'
p
'
p
x
1
F
ST1
F
ST1
b
Abb. 4.40 Axialkomponente der Strahlkraft. a Wirkung der Strahlkraft auf einen Wege-
ventilkolben b Abhängigkeit der Kraft F
ST1
vom Steuerspalt x
1

84 4 Berechnungsgrundlagen
In Abb. 4.40 a wird die Wirkung der durch den Flüssigkeitsstrom in einem Ventil
verursachten Strahlkräfte F
S
auf den Ventilkolben gezeigt.
Der Volumenstrom Q tritt über den Ringspalt x
1
in das Kontrollgebiet R ein
(s. Abschn. 4.3). Durch die Ablenkung an der Steuerkante des Kolbens trifft der
Fluidstrahl unter dem Winkel
H
auf den Ventilkolben. Dabei entsteht die in Strö-
mungsrichtung wirkende Strahlkraft F
S1
. Deren Normalkomponente (in Abb. 4.40
nicht dargestellt) wirkt am gesamten Umfang radial auf den Kolben. Ihre Resultie-
rende wird damit zu null. Die Tangentialkomponente F
ST1
wirkt bezogen auf den
Steuerspalt x
1
in Schließrichtung. Sie kann für stationäre, kavitationsfreie Strö-
mung nach Gl. (4.4.3) zu
FQv
ST111
U
H
cos (4.102)
berechnet werden. Beim Austritt des Volumenstromes aus dem Kontrollgebiet R
über den Ringkanal mit der Breite x
2
entsteht, da in diesem Falle der Ablenk-
winkel
H
2
= 90° ist, keine Axialkomponente der Strahlkraft F
S2
. Diese ist kleiner
als F
S1
, da wegen des größeren Spaltes x
2
die Strömungsgeschwindigkeit v
2
kleiner
als v
1
wird. Da in die Strahlkraft F
S
das Produkt aus Volumenstrom Q und Strö-
mungsgeschwindigkeit v eingeht (F
S
a
Q
2
), wirkt F
S
auch bei Umkehr der Strö-
mungsrichtung stets in der gleiche Richtung auf den Kolben. Die Tangential-
komponente F
ST1
, welche die erforderliche Schaltkraft für den Kolben beeinflusst,
wirkt also unabhängig von der Strömungsrichtung stets in Schließrichtung auf den
Kolben.
Bei instationärer Strömung im Kontrollgebiet R (z. B. beim Schalten des Ven-
tilkolbens) kommt zu der stationären Strahlkraft F
ST1
ein dynamischer Anteil
Fl
dQ
dt
ST dyn1
U
(4.103)
zum Beschleunigen des im Ventil befindlichen Fluidvolumens hinzu, der jedoch
im Vergleich zum stationären Anteil relativ gering ist [4.20].
Abb. 4.40 b zeigt qualitativ den experimentell ermittelten Verlauf der Strahl-
kraftkomponente F
ST1
des Ventils (nach Abb. 4.40) a als Funktion des Steuerspalts
x
1
. Dabei ist zu beachten, dass bei sehr kleinen Werten für x
1
ein Teil des von der
Pumpe geförderten Volumenstromes Q über das Druckbegrenzungsventil abfließt
und damit der Volumenstrom durch das Wegeventil zunächst mit x
1
ansteigt. Bei
größeren Spalten fließt der gesamte von der Pumpe geförderte Volumenstrom
durch das Wegeventil, und
'
p sowie F
ST1
nehmen mit weiter zunehmendem x
1
ab.
Der Maximalwert der Strahlkraft tritt beim kleinsten Spalt x
1
auf, bei dem der ge-
samte Pumpenstrom Q durch das Ventil fließt.
Der Winkel
H
, unter dem der Fluidstrahl auf den Kolben trifft, hängt von den
Spaltabmessungen und der Kontur der Steuerkanten ab. Er kann für Kolben und
Gehäuse mit scharfen Kanten und einem Kantenwinkel von 90° nach [4.21] an-
genähert ermittelt werden. In Abhängigkeit von Spaltbreite x, Spiel s und Kanal-
breite a kann mit den in Abb. 4.41 angegebenen Werten gerechnet werden:
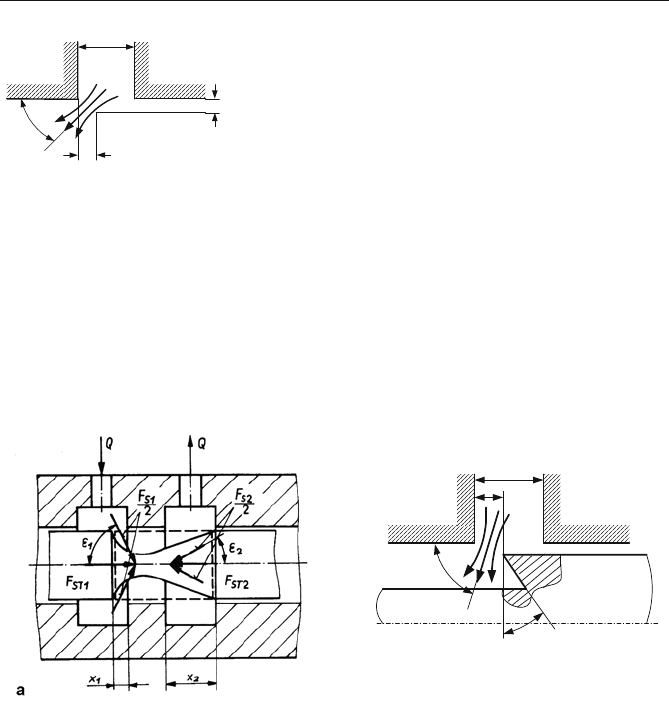
4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer Ventile 85
a
x
s
H
s = 0
H
= 69°
s = x
H
= 45°
s
x 45°
H
69°
s
!
x 21°
H
45°
Abb. 4.41 Einfluss des Steuerspaltes x und des Spieles s auf den Ablenkwinkel
H
Möglichkeiten zur Verringerung der tangentialen Strahlkraftkomponente F
ST
wer-
den in Abb. 4.42 dargestellt. Abb. 4.42 a zeigt, wie durch Gestaltung der Kolben-
kontur der austretende Strahl so umgelenkt werden kann, dass er unter dem Win-
kel
H
2
H
1
aus dem Kontrollgebiet austritt. Das hat eine Tangential-
komponente F
ST2
zur Folge, die F
ST1
entgegenwirkt. Damit wird
FFF
STres ST ST
12
. (4.104)
a
x
H!
69
0
E
b
Abb. 4.42 Beeinflussung der resultierenden Strahlkraft. a Strahlkraftumlenkung durch Kol-
bengestaltung b Beeinflussung des Ablenkwinkels
H
durch Gestaltung der Steuerkante
Abb. 4.42 b zeigt, wie der Winkel
H
durch Gestaltung der Kolbenkante ver-
größert und damit die Tangentialkomponente F
ST1
verringert werden kann.
Unausgeglichene Radialkräfte. Durch die Anordnung von Ringkanälen in den
Steuergehäusen von Ventilen (s. Abschn. 8.4.1.1) wird erreicht, dass der Druck im
Gehäuse stets auf den gesamten Kolbenumfang wirkt und die resultierende Radi-
alkraft zu null wird. Im Dichtspalt zwischen Kolben und Gehäuse fließt ein Leck-
volumenstrom, und der Druck im Spalt fällt längs des Strömungsweges ab. Ein
vollständiger Ausgleich der Radialkräfte am Kolben ist somit nur dann möglich,
wenn am gesamten Umfang der Druckverlauf gleich ist. Wird das nicht erreicht,
entsteht eine radiale Restkraft, welche als Normalkraft für die Reibpaarung Kol-
ben–Bohrung wirkt und zu nennenswerten Reibkräften führen kann, durch die das
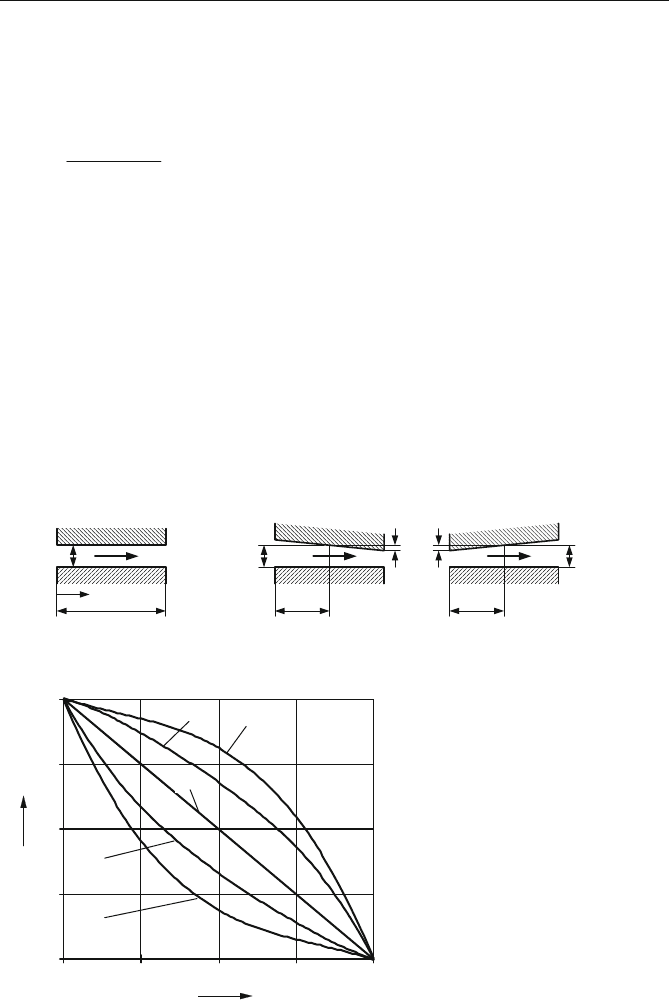
86 4 Berechnungsgrundlagen
Schaltverhalten des Ventils negativ beeinflusst wird. In einem Leckspalt herrscht
laminare Strömung (s. Abschn. 4.4.2). Damit gilt für den Druckverlauf in einem
ebenen Spalt, als welcher ein Leckspalt wegen der im Vergleich zur Spaltlänge
und zum Spaltumfang geringen Spalthöhe s betrachtet werden kann,
dp
Q
sb
dx
L
12
3
QU
(4.105)
s Spalthöhe
b Spaltbreite
x Strömungsweg.
Bei Parallelspalt (s = konst.) fällt der Druck längs des Strömungsweges linear
ab. Bei einem mit x sich veränderndem Spalt ist der Druckverlauf nicht linear.
Durch Abweichungen der Form von Kolben und Bohrung von Zylindrizität und
Kreisform wird in der Praxis der ideale Parallelspalt kaum erreicht. Abb. 4.43
zeigt drei Grundtypen ebener Spalte. Der Druckverlauf längs des Strömungsweges
in diesen Spalten wurde durch Integration der Gl. (4.105) ermittelt und in Abb.
4.44 dargestellt. Die Kurven im Diagramm zeigen, dass die Abweichung vom li-
nearen Druckverlauf mit zunehmender relativer Spaltänderung
'
s/s
0
zunimmt.
p
1
p
2
Q
L
Q
L
s
0
Q
L
s
0
s
0
x
l
l /2
l /2
'
s/2
'
s/2
a
b
c
Abb. 4.43 Spaltformen. a Parallelspalt b konvergenter Spalt c divergenter Spalt
0
0.25
0.5
0.75
1
0 0.25 0.5 0.75 1
x/l
p/
'
p
1
2 3
2'
3'
Abb. 4.44 Druckverlauf im ebenen Spalt. 1 Parallelspalt, 2 konvergenter Spalt
'
s/s
0
= 0,5,
3 konvergenter Spalt
'
s/s
0
= 1, 2’ divergenter Spalt
'
s/s
0
= 0,5, 3’ divergenter Spalt
'
s/s
0
= 1
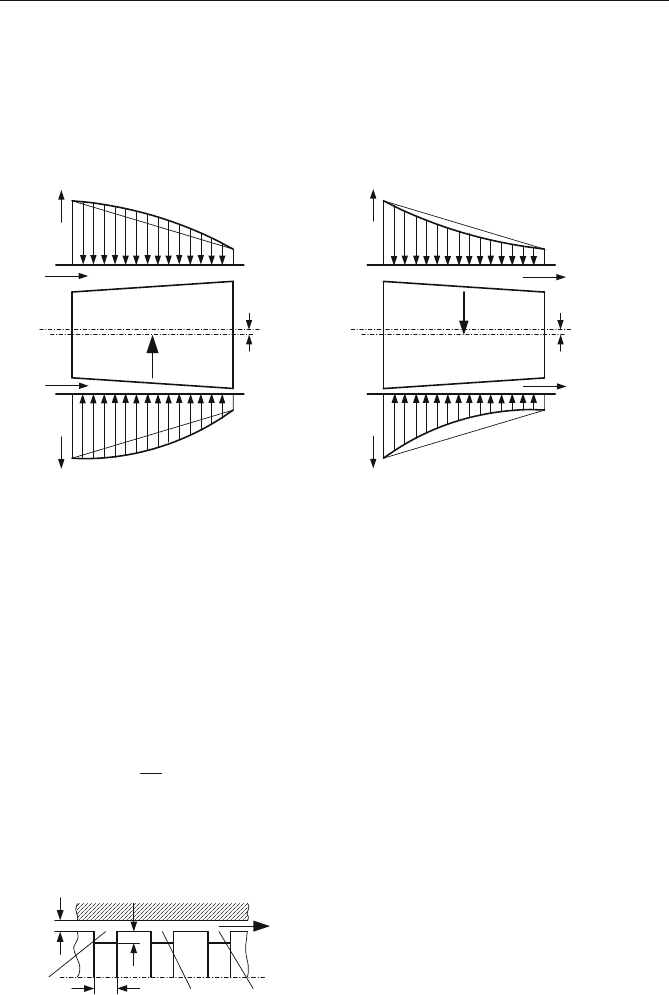
4.7 Strömungsbedingte Kräfte an Kolben hydraulischer Ventile 87
Die Fläche unter der Kurve p/
'
p = f(x/l) (ein Maß für die im Spalt wirkende
Kraft) ist bei konvergenten Spalten größer und bei divergenten Spalten kleiner als
bei einem Parallelspalt.
Die Anwendung dieser Ergebnisse auf einen konischen Kolben, der exzentrisch
in einer zylindrischen Bohrung angeordnet ist, wird in Abb. 4.45 dargestellt.
pp
p
p
p
1
p
1
p
2
p
2
Q
L
Q
L
Q
L
Q
L
'
F
'
F
-
e
e
ab
Abb. 4.45 Wirkung unausgeglichener Radialkräfte auf einen exzentrischen, kegligen Kol-
ben. a konvergenter Spalt b divergenter Spalt
Für qualitative Betrachtungen ist es ausreichend, die Druckverläufe, wie in
Abb. 4.45 gezeigt, an zwei diametral gegenüberliegenden Stellen des Kolbens he-
rauszugreifen. Die bei konvergentem Spalt auftretende unausgeglichene Radial-
kraft
'
F wirkt zentrierend. Bei divergentem Spalt wirkt
'
F in Richtung der Ex-
zentrizität, die dadurch vergrößert wird. Der Kolben kann einseitig an die
Bohrungswand gepresst werden. Dabei erreicht die Kraft
'
F ihren Größtwert. Sie
kann angenähert nach der Beziehung
'Fdl
e
s
pp 02
0
12
, (4.106)
berechnet werden [4.22]. Die Kraft
'
F hat großen Einfluss auf die Betätigungs-
kraft eines Ventils und kann zum Festklemmen des Kolbens führen.
s
0
Q
L
a
b
p
z1
p
z2
p
z3
p
1
p
2
Abb. 4.46 Kolben mit Rillen zum radialen Druckausgleich
