Siebertz K., Bebber D., Hochkirchen T. Statistische Versuchsplanung: Design of Experiments (DoE)
Подождите немного. Документ загружается.

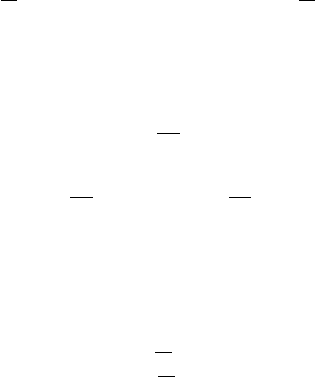
256 10 Sensitivitätsanalyse
ω
j
sind unterschiedliche und geschickt ausgewählte Frequenzen, die den Faktoren
1,···,n
f
zugeordnet sind. G
j
sind vorgegebene Transformationsfunktionen, auf die
später genauer eingegangen wird. Wenn nun s variiert wird, ändern sich alle Fak-
toren x
1
···x
n
f
gleichzeitig entlang einer Kurve durch den Faktorraum. Jeder Fak-
tor oszilliert dabei periodisch entsprechend seiner zugeordneten Frequenz ω
j
. Die
zu analysierende Ausgangsvariable y zeigt dabei je nach der Abhängigkeit von den
verschiedenen Faktoren unterschiedlich starke periodische Oszillationen bei den ge-
wählten Frequenzen ω
j
. Bei einer starken Abhängigkeit zwischen dem Faktor x
j
und y würde somit eine Frequenzanalyse der Ausgangsvariable y eine stärkere Am-
plitude bei der Frequenz ω
j
und deren harmonischen Schwingungen aufweisen als
bei Frequenzen unwichtiger Faktoren. Die Analyse der Frequenzen und deren har-
monischen Schwingungen kann dadurch als Maß für die Sensitivität zwischen den
Faktoren und y verwendet werden.
Ein genaue Berechnung der Sensitivität ist nur dann möglich, wenn die verwen-
dete Kurve, mit der der Faktorraum durchlaufen wird, nahe an jedem möglichen
Punkt des Faktorraums entlang läuft. Dieses kann nur dann erreicht werden, wenn
für jede gewählte Frequenz ω
j
gilt, dass sie nicht durch eine Linearkombination
(mit ganzen Zahlen) der anderen verwendeten Frequenzen dargestellt werden kann.
Ist dieses der Fall kann die Analyse der Ausgangsvariable y durch eine Auswertung
entlang der vorgegebenen Kurve durchgeführt werden. Es gilt beispielsweise für
den globalen Mittelwert von y:
¯y
r
= lim
t→∞
1
2t
Z
t
−t
y
r
x
1
(s),···x
n
f
(s)
ds = lim
t→∞
1
2t
Z
t
−t
y
r
(s)ds (10.37)
Cukier et al. [26] zeigt, dass bei Verwendung von positiven ω
j
eine Betrachtung der
Funktion y (s) zwischen −π und π ausreicht. Daraus folgt für die Berechnung von
¯y und
¯
D:
¯y
r
=
1
2π
Z
π
−π
y
r
(s)ds (10.38)
¯
D =
1
2π
Z
π
−π
y
2
(s)ds −
1
2π
Z
π
−π
y(s)ds
2
(10.39)
Die Funktion y (s) wird im folgenden Schritt als Fourier Reihe dargestellt:
y(s) =
∑
k
[A
k
cos(ks) + B
k
sin(ks)] k ∈ Z =
{
−∞,···,−1,0,1, +∞
}
(10.40)
mit A
k
=
1
2π
R
π
−π
y(s)cos (ks)ds
und B
k
=
1
2π
R
π
−π
y(s)sin (ks)ds
(10.41)
Das Spektrum der Fourier Reihe ist folgendermaßen definiert: Λ
k
= A
2
k
+ B
2
k
Da y (s) eine reelle Funktion ist gilt weiterhin A
k
= A
−k
,B
k
= B
−k
und Λ
k
= Λ
−k
.
Die gesuchten Werte für
ˆ
D und
ˆ
D
j
werden im Anschluss durch die Analyse des
Frequenzspektrums über den gesamten Frequenzbereichs
ˆ
D
beziehungsweise nur

10.3 Sensitivitätsanalyse bei nichtlinearen Modellen 257
an der Frequenz ω
j
und den harmonischen Frequenzen kω
j
(k = 1,2,3,. ..)
ˆ
D
j
bestimmt.
ˆ
D =
∑
k∈Z
−0
Λ
k
= 2
+∞
∑
k=1
Λ
k
mit Z
−0
= Z −
{
0
}
(10.42)
ˆ
D
j
=
∑
k∈Z
−0
Λ
kω
j
= 2
+∞
∑
k=1
Λ
kω
j
(10.43)
Die Sensitivität ist entsprechend der Sobol Kennzahlen (Kapitel 10.3.2) definiert
und entspricht der Sensitivität erster Ordnung nach Sobol, welche den Haupteffekt
von Faktor x
j
auf die Ausgangsvariable y beschreibt [172, 160]:
ˆ
S
FAST
j
=
ˆ
D
j
ˆ
D
(10.44)
eFAST
Zur Ermittlung des totalen Sensitivätsindex erweitert SALTELLI FAST zum erwei-
terten (extended) FAST (eFAST) [160]. Betrachtet werden dazu alle Frequenzen,
die nicht zu den Frequenzen ω
j
und den dazugehörigen harmonischen Frequenzen
kω
j
gehören. Diese Frequenzen enthalten alle Abhängigkeiten, die nicht den Haupt-
effekten der Faktoren x
1
···x
n
f
zugeordnet werden können. Folglich müssen diese
Frequenzen Abhängigkeiten der Ausgangsvariable y mit Interaktionen der Faktoren
enthalten (D −
∑
D
j
).
Zur Abschätzung des gesamten Effekts eines einzelnen Faktors x
j
wird ω
j
ei-
ne deutlich höhere Frequenz zugewiesen als allen anderen Faktoren [160]. Bei
der Analyse der harmonischen Frequenzen kω
j
zeigt sich, dass bei steigendem
k = 1,2,3,4, ... die Amplitude schnell gegen Null strebt. Für die Abschätzung des
Effekts eines Faktors sind somit nur die ersten harmonischen Frequenzen zu be-
rücksichtigen. Da die Frequenz ω
j
deutlich größer als die Frequenzen ω
−j
gewählt
wurde, kann der Effekt von allen Faktoren ohne x
j
durch Betrachtung der Frequen-
zen bis ω
j
/2 abgeschätzt werden. Es wird dabei ω
j
/2 gewählt um Interferenzen mit
dem Faktor x
j
, also der Frequenz ω
j
, auszuschließen. Allgemein wird der Effekt
aller Faktoren jeder Ordnung ohne x
j
wie folgt abgeschätzt [160, 149]:
ˆ
D
−j
= 2
ω
j
/2
∑
k=1
Λ
k
(10.45)
Der totale Sensitivitätsindex wird damit berechnet durch:
c
S
T
j
FAST
= 1 −
ˆ
D
−j
ˆ
D
(10.46)
Transformationsfunktion
Die Wahl der Transformationsfunktionen G
j
und der Frequenzen ω
j
kommt eine
hohe Bedeutung bei der Bestimmung der Sensitivitätswerte zu. In der Literatur wer-
den unterschiedliche Funktionen für G
j
vorgeschlagen [26, 27, 91, 160]. SALTELLI
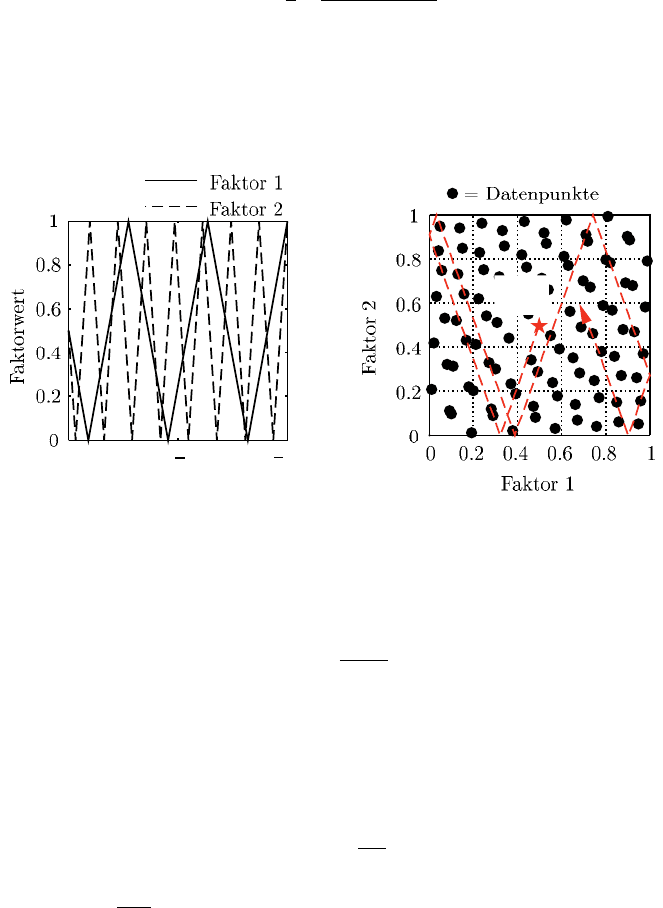
258 10 Sensitivitätsanalyse
schlägt die folgende relativ einfache Funktion vor, die im Bereich [−π,π] definiert
ist und den Bereich [0,1] oszillierend durchläuft.
x
j
=
1
2
+
asin(sin[ω
j
s])
π
(10.47)
Werden beispielsweise zwei Frequenzen
{
ω
1
,ω
2
}
=
{
11,31
}
gewählt, wird der
zwei-dimensionale Raum, wie in den Abbildungen 10.2a und 10.2b dargestellt,
durchlaufen. Entlang der Kurve werden beliebig viele Datenpunkte zur Analyse der
Sensitivität gewählt (10.2b).
Abb. 10.2a Transformation, ω
1,2
= (11,31) Abb. 10.2b Faktorraum
Wahl der Frequenzen
Zur Auswahl der Frequenzen und zur Bestimmung von S
T
j
FAST
werden folgende
Regeln verwendet [160].
ω
j
= b
n
r
−1
2M
c (10.48)
Die Gaußklammer b·c bezeichnet dabei die größte ganze Zahl, die kleiner oder
gleich der Zahl in der Gaußklammer ist. M ist eine ganze Zahl größer Null und gibt
die Anzahl der berücksichtigten harmonischen Schwingungen an. Typische Werte
für M liegen bei M ≥4. Die Frequenzen der übrigen Faktoren werden mit folgender
Berechnungsvorschrift bestimmt.
ω
max
=
j
ω
j
2M
k
(10.49)
ω
−j
(j
1 +
ω
max
n
f
−1
(k −1)
k
wenn ω
max
≥ n
f
−1
(k mod ω
max
) + 1 wenn ω
max
< n
f
−1
mit k = 1 ···
n
f
−1
(10.50)
−π
−
3
4
π
−
1
2
π · · ·
s = −π · · · π
s = 0
Start
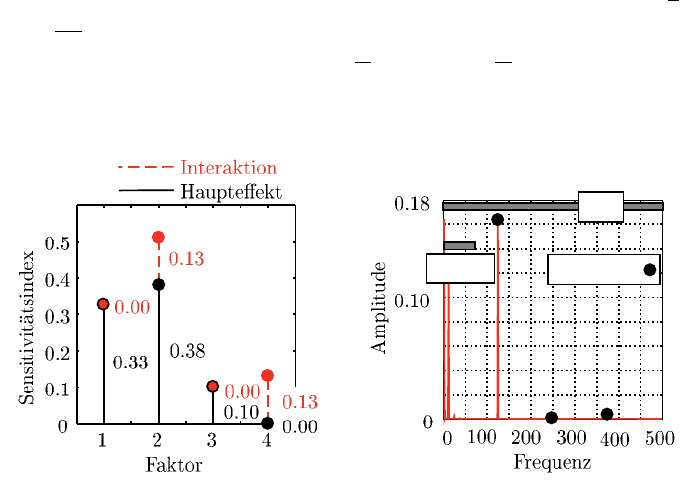
10.3 Sensitivitätsanalyse bei nichtlinearen Modellen 259
Als Beispiel wird die folgende Funktion betrachtet:
y = x
1
+ x
2
+ x
2
3
+ x
2
x
4
mit x
j
∈ [−1···1] (10.51)
x
1
und x
3
weisen nur Haupteffekte und x
4
lediglich Interaktionen auf. Zur Unter-
suchung der Sensitivität wird n
r
= 1000 und M = 4 gewählt, wodurch sich eine
Frequenz von ω
j
= 124 für den zu untersuchenden Faktor x
j
ergibt. Für die übrigen
Frequenzen werden folgende Frequenzen ermittelt: ω
−j
=
{
1,6,11
}
. Die Sensitivi-
tätsanalyse mittels eFAST ergibt die in Abbildung 10.3a dargestellten Ergebnisse.
x
1
und x
2
haben danach den größten Einfluss auf die Varianz von y. Durch die Be-
grenzung der Faktoren auf den Bereich −1 ≤ x
j
≤ 1 ist der Einfluss von x
3
durch
seinen geradzahligen Exponenten bereits deutlich kleiner. Abbildung 10.3b zeigt
die FFT (Fast Fourier Transformation) der Sensitivitätsanalyse des Faktors x
2
.
ˆ
D
2
und
ˆ
D
−2
2
berechnen sich dabei durch die Summe aller Amplituden beziehungsweise
durch die Summe der Frequenzen bis ω =
ω
j
2
. Der Wert von
ˆ
D
2
2
wird hingegen durch
die Summe der Amplituden bei ω
2
= 124 und der drei harmoinschen Frequenzen
(M = 4) bestimmt.
Abb. 10.3a Sensitivitätsanalyse Abb. 10.3b FFT zur SA des Faktors 2
Zur Berechnung aller totalen Sensitivätswerte inklusive der Haupt- und Interak-
tionskennwerte werden mit eFAST lediglich n = n
r
n
f
Berechnungen des Modells
benötigt. Werden nur die Effekte erster Ordnung untersucht, reduziert sich der Auf-
wand auf n
r
Berechnungen. eFAST wird diese für den Praxiseinsatz empfohlen,
weil sie eine einfache, schnelle und aussagekräftige Analyse ist.
ˆ
D/2
ˆ
D
2
/2 =
P
ˆ
D
−2
/2
260 10 Sensitivitätsanalyse
10.4 Zusammenfassung
Die Sensitivitätsanalyse bietet bei vielen Analysen hilfreiche Informationen zum
Verständnis und zur Weiterentwicklung von Simulationsmodellen und technischen
Systemen. Dabei werden allgemein die drei Bereiche Faktor Screening, lokale- und
globale Sensitivitätsanalyse unterschieden. In allen Bereichen wird nach Zusam-
menhängen zwischen der Varianz von Eingangsfaktoren und Ausgangsvariablen
gesucht, die als Basis für weitere Entscheidungen dienen. Neben klassischen Ver-
fahren, die für lineare Modelle entwickelt worden sind (Normierte Regressionsko-
effizienten, PSS, PRESS, PCC, CPD), sind verschiedene Algorithmen vorhanden,
die auch bei Verwendung nichtlinearer Modelle aussagekräftige Ergebnisse liefern
(Korrelationsverhältnis, Sobol, FAST, eFAST). Dabei ermöglichen die Verfahren
FAST und eFAST, unabhängig vom gewählten Metamodellansatz, mit geringem Re-
chenaufwand genaue und aussagekräftige Ergebnisse.
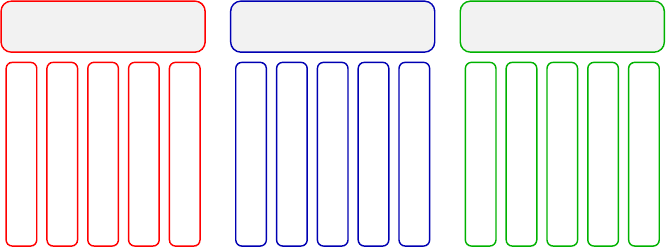
Kapitel 11
Strategie
11.1 Einleitung
Statistische Versuchsplanung hat viel mit Mathematik zu tun. Letztlich sind aber oft
die nicht-mathematischen Dinge erfolgsentscheidend. Zum Beispiel hilft der struk-
turierte Ablauf, ein Problem zielgerichtet anzugehen. In sehr vielen Fällen sind gan-
ze Arbeitsgruppen an Vorbereitung und Durchführung einer Versuchsreihe beteiligt,
mitunter sogar abteilungsübergreifend. Die DoE hat in gewisser Weise einen team-
bildenden Character, da sie nicht nur einen favorisierten Faktor nach dem anderen
untersucht, sondern von vornherein auf die gleichzeitige Analyse mehrerer Fakto-
ren ausgerichtet ist. Damit wird das Projekt zu einer Sache gemeinsamen Interesses.
Nachdem die theoretischen Grundlagen geklärt sind, soll dieses Kapitel dem Leser
einige praktische Hinweise vermitteln und so den Einstieg in die Methode erleich-
tern.
qualitative
Systembeschreibung
Sichtung
der Faktoren
Detailuntersuchung
Systemgrenzen
Qualit¨atsmerkmale
Einflußgr¨oßen
Zielbereiche
Meßbarkeit
Faktor e nauswahl
Stufenfestlegung
Screening Plan
Versuchsdurchf¨uhrung
Beschreibungsmodell
Faktor e nauswahl
Mo dell + Versuchsplan
Versuchsdurchf¨uhrung
Beschreibungsmodell
Optimierung
Abb. 11.1 Schematischer Ablauf einer DoE-Anwendung. Die drei Phasen werden nacheinander
durchlaufen und bauen aufeinander auf.
K. Siebertz et al., Statistische Versuchsplanung, VDI-Buch, 261
DOI 10.1007/978-3-642-05493-8_11, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
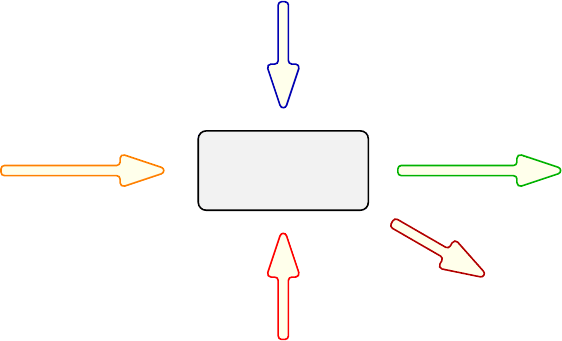
262 11 Strategie
11.2 Qualitative Systembeschreibung
Die qualitative Systembeschreibung mit Hilfe eines Parameterdiagramms ist der
Dreh- und Angelpunkt jeder DoE. Fehler die hier gemacht werden, kann kein Sta-
tistiker jemals wieder korrigieren. Bei einer guten qualitativen Systembeschreibung
kommt man mit fast jedem Versuchsplan zum Ziel, bei einer schlechten überhaupt
nicht.
Signalgr¨oßen
St¨orgr¨oßen
Steuergr¨oßen
Qualit¨atsmerkma le
Error States
System
Abb. 11.2 Parameterdiagramm. Steuer-, Signal- und Störgrößen nehmen Einfluss auf das Sys-
tem. Ein Teil der Ergebnisse ist erwünscht, die Qualitätsmerkmale. Error States kennzeichnen die
unerwünschten Ergebnisse. Im Abschnitt Robustes Design wurde dieses Diagramm im Detail vor-
gestellt.
Zunächst müssen Systemgrenzen und Qualitätsmerkmale definiert werden. In der
Praxis kann sich hierbei eine längere Diskussion entwickeln. Diese ist hilfreich und
sollte auf keinen Fall abgewürgt werden. Hierzu einige Kontrollfragen, quasi als
Checkliste:
Welches System wird untersucht?
Wo sind die Systemgrenzen?
Ist das Team in Anbetracht der so definierten Systemgrenzen vollständig?
Welche Aufgabe hat das System?
Was unterscheidet ein gutes von einem schlechten System?
Ist das Qualitätsmerkmal messbar?
Wie gut lässt sich das Qualitätsmerkmal messen?
11.2 Qualitative Systembeschreibung 263
Gibt es eine messbare Ersatzgröße?
Was sollte man sicherheitshalber zusätzlich aufzeichnen?
Gibt es mehrere Qualitätsmerkmale?
Welchen Wert des Qualitätsmerkmals wollen wir jeweils erreichen?
Welches Qualitätsmerkmal hat Vorrang?
Sind wir mit dem System vollständig zufrieden, wenn die gewählten Qualitätsmerk-
male in den gewünschten Bereich kommen?
Im nächsten Schritt geht es um die Festlegung der Faktoren für den Versuchs-
plan. Hierzu sollte man zunächst etwas Abstand von den möglicherweise vorhande-
nen Einschränkungen gewinnen. Es ist immer besser, aus einer großen Liste einige
Favoriten auszuwählen, als sich vorschnell auf die erstbesten Größen festzulegen.
Clevere DoE-Berater walzen diesen Teil der Gruppenaktivität kräftig aus, durchaus
im Sinne des Gesamterfolgs. Bewährt haben sich Metaplan Karten und Pinnwand,
damit keine Gedanken verloren gehen und eine nachfolgende Sortierung möglich
ist.
Welche Parameter beeinflussen das System? (Brain-Storming mit Papp-Karten)
Gehören sie wirklich zum System (Steuergrößen)?
Falls nein, sollten sie als Störgrößen betrachtet werden ?
Gibt es sonstige Störgrößen?
Gibt es Signalgrößen, die den Betriebsbereich des Systems beschreiben?
Gab es in der Vergangenheit einen bislang noch nicht genannten Parameter, der
Einfluss hatte? Gibt es Parameter, bei denen wir uns nicht sicher sind?
Kann man die Parameter reproduzierbar im Versuch einstellen?
Sind die Parameter voneinander unabhängig?
Gibt es kritische Kombinationen der Parameter untereinander?
Ist eine Veränderung des Parameters in der Serienproduktion durchsetzbar?
Was wissen wir bereits über den Parameter?
Wenn man alle Fragen beantworten kann, weiss man schon recht viel über sein
System. Selten fängt man bei Null an, daher ist es immer gut, die Vorgeschichte
systematisch zusammenzutragen. Es würde an ein Wunder grenzen (oder deutet auf
ein müdes Team hin), wenn auf Anhieb alle Parameter in einem Versuchsplan Platz
finden. Ausdünnen gehört zur Übung, sollte aber behutsam vonstatten gehen. Die
Metaplan Karten lassen sich auf einer Pinnwand wunderbar sortieren. Doppelnen-
nungen sollte man nicht abhängen (wertet ab), sondern elegant durch Karten glei-
cher Nennung abdecken. Motto: Alles ist richtig. Oft redet sich das Expertenteam
bei der Parametersuche warm und ist sich am Ende einig, dass eine neue Versuchs-
reihe unbedingt nötig ist. Dann sind alle im Boot (vor allem, wenn der DoE-Berater
darauf achtet, dass jede Schlüsselfigur seinen Parameter unterbringen darf).
264 11 Strategie
11.3 Versuchsdurchführung und Auswertung
Bei der nachfolgenden DoE werden aus der Fülle der Parameter die Faktoren des
Versuchsplans ausgewählt. In der Regel ist ein zweistufiges Vorgehen empfehlens-
wert. Zunächst wird man viele Faktoren einem Screening unterziehen und dann we-
nige Faktoren im Detail untersuchen. Dies hat viele Vorteile. Zum einen sollte man
nicht gleich am Anfang die Zahl der Faktoren unnötig beschränken. Jeder nicht be-
achtete Parameter geht verloren und man weiß letztlich nie so genau, ob er nicht
vielleicht doch einen großen Einfluss hat. Ein einziger riesig großer Versuchsplan
scheitert in der Praxis sehr oft. Besser sind Versuchspläne in vernünftiger Größe, die
in endlicher Zeit ein brauchbares Zwischenergebnis liefern. Welche Größe passend
ist, hängt von den Randbedingungen ab. Neben Kosten und Versuchsaufwand spielt
die verfügbare Zeit eine große Rolle. In Krisensituationen kann es sinnvoll sein, be-
wust auf kleinere Felder auszuweichen, um schnell an erste Ergebnisse zu kommen.
Möglicherweise denkt man nach der ersten Versuchsreihe auch anders über die Stu-
feneinstellungen und kann diese in der zweiten Versuchsreihe passend korrigieren.
Bei der Screening-DoE wird man auf große Kontraste hinarbeiten, also möglichst
weite Stufenabstände wählen. Die nachfolgene Optimierung arbeitet möglicherwei-
se mit einem enger abgesteckten Faktorraum.
Bieten sich einige Stufeneinstellungen von vornherein an?
Wo sind die technisch sinnvollen Grenzen? (Bauraum, Kosten, Verfügbarkeit)
Passen die Stufenabstände der unterschiedlichen Faktoren zueinander?
Sind einzelne Faktoren durch besonders weite Abstände bevorzugt?
Könnte es als Folge von Nichtlinearitäten im mittleren Einstellungsbereich völlig
andere Ergebnisse geben?
Screening bedeutet: sichten und ausdünnen. Zunächst sollte man also möglichst
viele Parameter als Faktoren in den Versuchsplan aufnehmen. Vorversuche können
notwendig sein, um zu testen, ob kritische Kombinationen im Versuchsplan reali-
sierbar sind. Im Zweifelsfall liefert ein großes Screening-Feld mehr Informationen
als mehrere kleine Felder. Außerdem ist es besser, zusätzliche Kombinationen zu
testen, als die gleiche Kombination mehrfach zu wiederholen. Blockbildung und
Randomisierung sollten eingesetzt werden, wo es sinnvoll ist. Aus all diesen Er-
wägungen erfolgt nun die Auswahl des passenden Screening-Versuchsplans. In der
Regel bleibt man bei zweistufigen Versuchsplänen, wobei sich dicht besetzte Pläne
nach dem Yates-Standard und vor allem Plackett-Burman Pläne anbieten.
Steht der Versuchsplan, kommt die Logistik in’s Spiel. Alle beteiligten Personen
müssen die notwendigen Informationen bekommen. Material muss besorgt werden.
Prüfstände werden belegt. Nicht selten scheitern gute Pläne an einer mangelhaften
Ausführung. Oft ist nicht einmal böser Wille dabei, klare Darstellung ist Trumpf.
Der “Operator” (also das Prüfstandspersonal) braucht einen Versuchsplan im Klar-
text und kann mit − oder + nichts anfangen. Es lohnt sich immer, vor Ort ein wenig
Zeit zu investieren und die Beteiligten in die Grundprinzipien der DoE einzuweihen.
Die gesamte Testreihe sollte möglichst in einem Zug durchgeführt werden. Dies er-
11.3 Versuchsdurchführung und Auswertung 265
fordert eine lückenlose Materialbeschaffung (Stückliste) mit entsprechender Vorbe-
reitung (Zeitplan, Budget,..). Normalerweise sind gute Prüfstände voll ausgelastet.
Jede Versuchsreihe muss also vorher korrekt eingesteuert werden (Umfang, Rüstzei-
ten, etc.). Wer den Betrieb aufhält (zum Beispiel weil das Material fehlt) fliegt vom
Prüfstand. Eine DoE bietet in dieser Situation Vor- und Nachteile. Vorteilhaft ist
die Möglichkeit, ohne Verzögerung in einem Zug mehrere Faktoren untersuchen zu
können. Problematisch ist eine abgebrochene Messreihe, weil sie in der Regel nicht
mehr auszuwerten ist. Dann ist entweder alles verloren oder man muss die Akti-
on mit entsprechendem Aufwand wiederholen, zumindest die fehlenden Versuche.
Wiederholungen und Bestätigungsläufe gehören dazu, also sollten sie von Anfang
an mit eingeplant werden. Wichtig, bereiten Sie die Entscheidungsträger darauf vor,
dass es nicht bei der Screening DoE bleiben wird. Allen sollte das geplant zwei-
stufige Vorgehen bekannt sein, damit es nicht nach einer verpatzten und dann auf
andere Weise wiederholten Versuchsreihe aussieht. Normalerweise ist es kein Pro-
blem, diesen Punkt zu kommunizieren, weil jede andere Strategie mehr Versuche
beinhalten würde.
Nach der Versuchsdurchführung steht die statistische Modellbildung an. Hier
müssen Spezialisten aus den Fachabteilungen und Statistiker Hand in Hand arbeiten.
Lassen sich die abgeleiteten Schlussfolgerungen fachlich erklären?
Ist das Beschreibungsmodell hinreichend genau? (Fehlen wichtige Faktoren?)
Welche Faktoren sind signifikant?
Gibt es Faktoren, bei denen sich bereits eine optimale Einstellung gezeigt hat?
(Diese Faktoren bleiben im weiteren Verlauf bei dieser Einstellung.)
Liegen möglicherweise starke Wechselwirkungen vor ?
Liegen möglicherweise starke Nichtlinearitäten vor?
Gibt es unterstützende CAE-Modelle oder Komponententests?
Die zweite Runde verläuft ähnlich. Nach der Faktorenauswahl folgt die Fest-
legung des Versuchsplans. Bei Bedarf sind neue Stufenabstände einstellbar. Mög-
licherweise ändert sich auch die Grundeinstellung des Systems, indem einige der
im Screening untersuchten Faktoren auf eine neue Einstellung gebracht werden.
Mit Hilfe der verfügbaren Ergebnisse muss eine Entscheidung getroffen werden,
welches Beschreibungsmodell für die Detailuntersuchung angestrebt wird. Wech-
selwirkungen und Nichtlinearitäten spielen dabei eine Rolle. Im Zweifelsfall ist die
schlichte Variation eines einzelnen Parameters eine wertvolle Zusatzinformation.
Versuchsplan und Beschreibungsmodell sind miteinander verbunden, von zwei Aus-
nahmen abgesehen. 1. Monte-Carlo Versuchspläne und deren Derivate (Hypercubes,
Space-Filling Design) beinhalten keine Bindung an ein Modell. 2. Man kann zwei-
stufige Versuchspläne der Auflösungsstufe V bei Bedarf nachträglich erweitern, um
auch quadratische Effekte zu erfassen. Die zweite Versuchsreihe geht auf den Prüf-
stand und die zweite Auswertung erfolgt. Diesmal sind natürlich die Anforderung
an die Modellgenauigkeit höher. Außerdem geht es um die Festlegung der vorge-
schlagenen Systemeinstellung, was immer mit Bestätigungsläufen verbunden sein
sollte. Die Besprechung der Ergebnisse sollte wieder im Team erfolgen. Zum einen
ist es wichtig, die Schlussfolgerungen zu hinterfragen und passende technische Er-
