Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung
Подождите немного. Документ загружается.

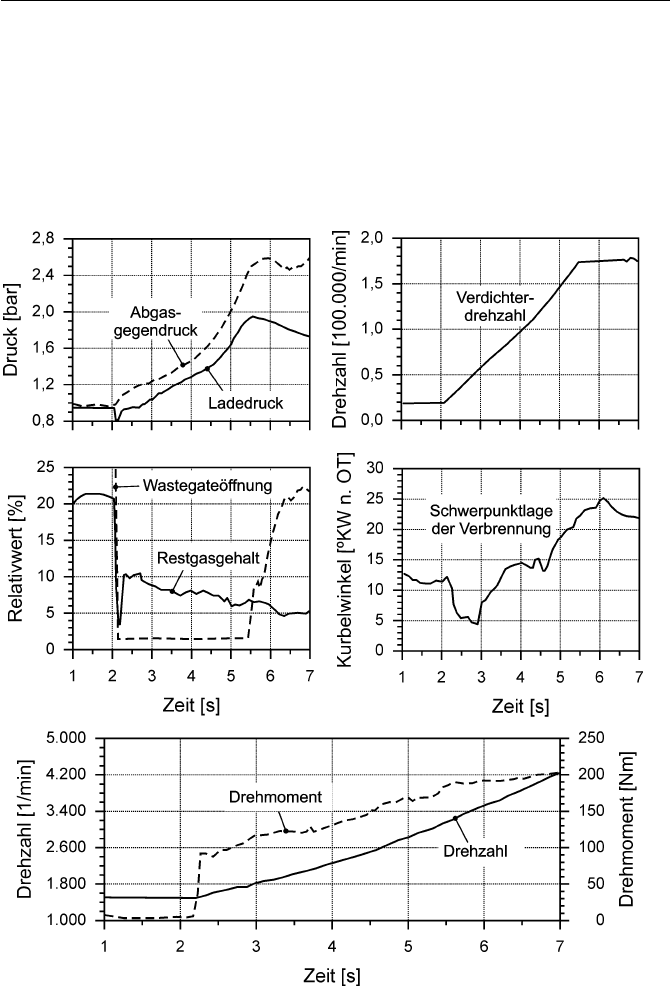
3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 95
beschrieben werden. Die wesentlichen Größen sind der Lade- und Abgasge-
gendruck, die Verdichter- und Motordrehzahl, das Drehmoment, der Restgasge-
halt sowie Zündzeitpunkt, Brenndauer und Schwerpunktlage der Verbrennung.
[MIE03] hat auf Grundlage eines Klasse-C-Fahrzeugs mit turboaufgeladenem
4-Zylinder-BDE-Ottomotor (
V
H
= 1,4 dm
3
, P
Nenn
= 110 kW, M
Max
= 210 Nm)
einen Beschleunigungsvorgang im 2. Gang bei einer Startdrehzahl von 1.500
1/min simuliert. Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich die hierbei ablaufenden Pro-
zesse auf, siehe Abb. 3.21.
Abb. 3.21. Zeitlicher Verlauf der motorischen Prozessgrößen während eines Beschleuni-
gungsvorganges eines turboaufgeladenen BDE-Ottomotors [MIE03]

96 3 Downsizing
Nach dem Öffnen der Drosselklappe sinkt der Druck davor infolge des Druck-
ausgleichs kurzfristig ab, sodass sich das saugmotorische Drehmoment um 0,2 s
verzögert aufbaut. Der erhöhte Drehmomentbedarf bewirkt ein Schließen des
Wastegates mit der Folge eines Anstiegs des Abgasgegendruckes. Trotzdem der
Abgasgegendruck stets höher ist als der Ladedruck und die verdichtete Ansaugluft
im Teillastbetrieb zudem noch gedrosselt wird, ist ein Ladungswechsel dennoch
möglich, da die Steuerzeiten AÖ und EÖ zeitlich verschoben sind. Es ergeben sich
jedoch relativ hohe Restgasanteile, da ein Teil des Abgases während der Ventil-
überschneidungsphase aufgrund des negativen Spülgefälles in den Ansaugkanal
expandiert.
Das Zusammenspiel von Abgasgegendruck und Ladedruck hat generell einen
erheblichen Einfluss auf den Restgasanteil. Das schlagartige Öffnen der Drossel-
klappe bewirkt einen raschen Anstieg des Saugrohrdruckes, sodass der Restgasan-
teil deutlich absinkt. Hohe Restgasanteile sind zu vermeiden, da sie die Zylinder-
füllung begrenzen und infolge der Erhöhung der Ladungstemperatur die Klopfnei-
gung des Motors erhöhen sowie eine Erhöhung der zyklischen Schwankungen
bewirken.
Der Anstieg des Ladedruckes resultiert aus der zunehmenden Verdichterdreh-
zahl. Während dieser Phase ist die Leistung der Abgasturbine größer als die vom
Verdichter aufgenommene Leistung. Die Differenz dient zur Beschleunigung des
Turboladerlaufzeugs. Sobald der gewünschte Ladedruck erreicht ist, öffnet das
Wastegate, und es stellt sich ein stationäres Leistungsgleichgewicht am Abgastur-
bolader ein. Mit dem Anstieg des Ladedruckes steigt auch das Drehmoment des
Motors und in der Folge auch die Drehzahl. Aufgrund des zunehmenden Abgas-
gegendruckes, der direkt die Ausschiebearbeit bestimmt, ist die Drehmomentstei-
gerung jedoch nicht identisch mit der Ladedruckerhöhung. Die höhere Zylinder-
füllung führt zu einer schnelleren Energieumsetzung (Brenndauer sinkt) und er-
fordert darüber hinaus eine klopfbedingte Verschiebung des Zündzeitpunktes nach
„spät“. Die damit verbundenen späteren Schwerpunktlagen der Verbrennung re-
duzieren des motorischen Wirkungsgrad und damit auch das mögliche Volllast-
Drehmoment.
Die beschriebene Problematik des Low-End-Torque sowie des Beschleuni-
gungsverhaltens aus niedrigen Drehzahlen wird mit steigendem Ladedruckniveau
immer ausgeprägter. Abb. 3.22 zeigt den prinzipiellen Unterschied von konventi-
oneller einstufiger Aufladung und einstufiger Hochaufladung für eine Fahrzeug-
anwendung. Auch hier ist das deutlich geringere Anfahrdrehmoment sowie das
schlechtere Beschleunigungsverhalten des Motors mit Hochaufladung dargestellt.
Mit zunehmender Leistungsdichte wird die Diskrepanz zwischen stationärem und
transientem Motorbetriebsverhalten größer. Zudem ist der Drehzahlbereich des
maximalen Mitteldruckes im Vergleich zur konventionellen Aufladung kleiner,
und beim Beschleunigen wird die stationäre Volllastkurve erst bei höherer Dreh-
zahl erreicht. Im Falle der Hochaufladung mit effektiven Mitteldrücken deutlich
oberhalb von 20 bar müssen demnach in jedem Fall geeignete Maßnahmen zur
Formung des Drehmomentverlaufes sowohl für den stationären als auch für den
instationären Betrieb getroffen werden.
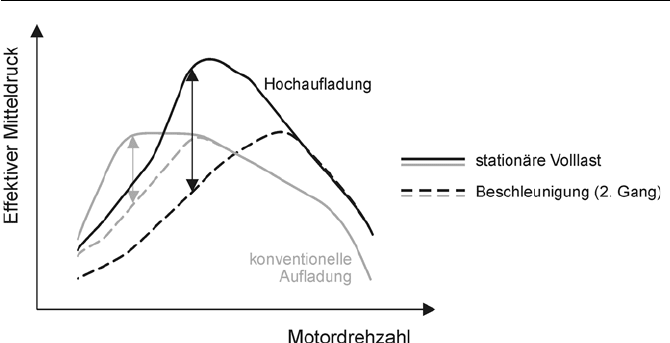
3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 97
Abb. 3.22. Schematischer Vergleich von einstufiger konventioneller und einstufiger Hoch-
aufladung (Abgasturboaufladung) im Fahrzeugeinsatz
Eine weitere Einflussgröße auf die Erzeugung des Ladedruckes ist der thermo-
dynamische Zustand der in den Turboverdichter eintretenden Luft sowie das von
außen auf den Motor aufgeprägte Lastprofil. Bei extremen äußeren Randbedin-
gungen, die z.B. bei großer geodätischer Höhe (niedrige Luftdichte), tiefen Tem-
peraturen (hohes Motorreibmoment, geringe Abgasenthalpie) oder bei großen
Steigungen (hohes Lastmoment) auftreten, reagieren hochaufgeladene Motoren
sehr viel empfindlicher als Motoren mit mäßigen Aufladegraden. Unter diesen
Extrembedingungen kann es zu einem übermäßigen Abfall des Drehmomentes
kommen, sodass der Fahrzeugbetrieb nicht mehr möglich ist. Hohe Druckverluste
im Ansaugsystem oder ein sinkender Luftdruck z.B. durch Motorbetrieb in
Höhenlagen können zu einer unzulässigen Annäherung oder sogar Überschreitung
der maximalen Laderdrehzahl führen und damit die Betriebssicherheit der Abgas-
turboladers einschränken. Dieses Szenario ist unter allen Umständen zu vermei-
den.
3.4.2 Die Klopfproblematik beim Ottomotor
Die als Klopfen bezeichnete detonierende Verbrennung tritt brennverfahrensbe-
dingt hauptsächlich beim Ottomotor auf. Während die Klopfproblematik bereits
beim freisaugenden Ottomotor in oberen Lastbereichen ständig präsent ist, wird
dieser Sachverhalt bei aufgeladenen Motoren noch deutlich verschärft [GÜN03]
und stellt damit den begrenzenden, brennverfahrensseitigen Faktor hinsichtlich der
Ausweitung des maximalen effektiven Mitteldruckes dar. In der Folge limitiert die
Selbstzündung im Endgas viele wirkungsgradsteigernde Maßnahmen. Neben
Zündaussetzern stellt die klopfende Verbrennung damit die maßgebendste Be-
grenzung der ottomotorischen Verbrennung dar und ist speziell für die Umsetzung
eines Downszing–Konzeptes von großer Bedeutung.
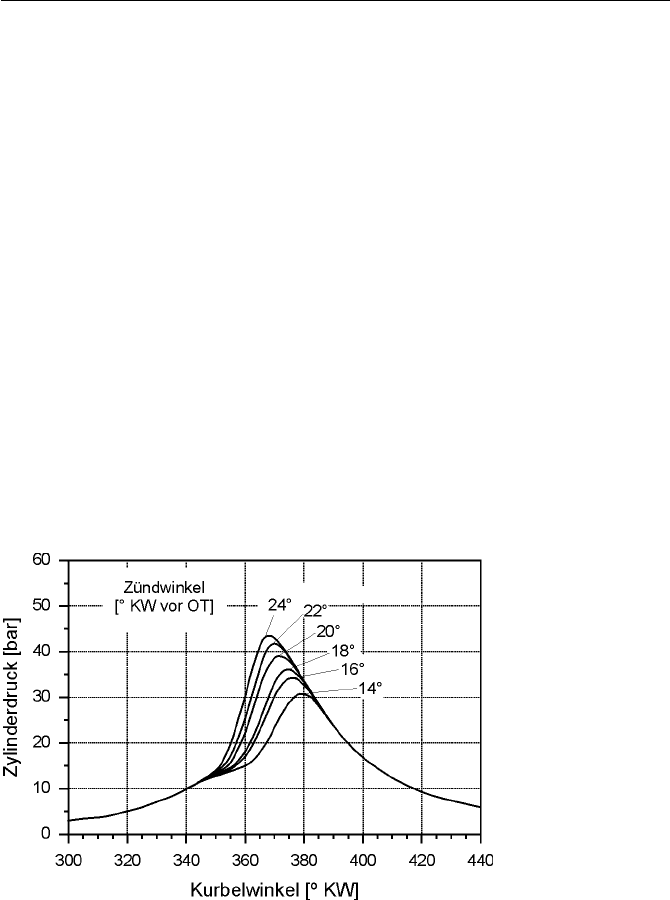
98 3 Downsizing
Wie in Kap. 2.2 gezeigt wurde, sind für hohe Motor-Wirkungsgrade grundsätz-
lich hohe geometrische Verdichtungen erforderlich. Das Verdichtungsverhältnis
von Ottomotoren muss jedoch durch die Gefahr klopfender Verbrennung begrenzt
werden, womit im Vergleich zum Dieselmotor generelle Verbrauchsnachteile
verbunden sind. Mit Hilfe moderner Antiklopfregelungen ist es dennoch gelungen,
den Motor nahe an der Klopfgrenze zu betreiben. Hierbei wird mit geeigneten
Sensoren (sogenannte Klopfsensoren) die durch klopfende Verbrennung intensi-
vierte Körperschallabstrahlung des Kurbelgehäuses erfasst und der Zündzeitpunkt
soweit nach „spät“ verstellt, bis wieder eine deflagrierende Verbrennung abläuft.
Neuere Messverfahren auf optischer Basis erlauben bei Forschungsmotoren sogar
die Lokalisierung der Klopforte innerhalb des Brennraumes.
Da die Verbrennung beim Ottomotor durch den Zündfunken eingeleitet wird,
hat dieser Betriebsparameter einen dominierenden Einfluss auf das Klopfverhalten
des Motors. In Abb. 3.23 sind mehrere Zylinderdruckverläufe dargestellt, die sich
aus verschiedenen Zündwinkeln ergeben. Da es sich hierbei um einen Teillast-
Betriebspunkt handelt, ist es grundsätzlich möglich, einen optimalen Zündwinkel
einzustellen, ohne dass es zu Klopferscheinungen kommt. Optimal bedeutet, dass
bei konstanter Kraftstoffmenge sowohl der Mitteldruck als auch der Wirkungsgrad
des Motors in diesem Betriebspunkt maximale Werte annehmen können. Bei spä-
teren Zündwinkeln wird der Verbrennungsschwerpunkt zunehmend in den Bereich
der Abwärtsbewegung des Kolbens verlegt, sodass der Zylinderspitzendruck ab-
sinkt und Kraftstoffverbrauch sowie Abgastemperatur deutlich ansteigen.
Abb. 3.23. Einfluss des Zündwinkels auf den Zylinderdruckverlauf
Bei Vorverlegung des Zündzeitpunktes läuft die Verbrennung infolge der höhe-
ren Ladungsdichte (kleineres Brennraumvolumen) schneller ab. Als Ergebnis
steigen Zylinderspitzendruck und Spitzentemperatur an. Werden die für eine de-
flagrierende Verbrennung zulässigen Grenzwerte von Druck und Temperatur
überschritten, kommt es zu Selbstzündungserscheinungen im Endgas und ggf. zu
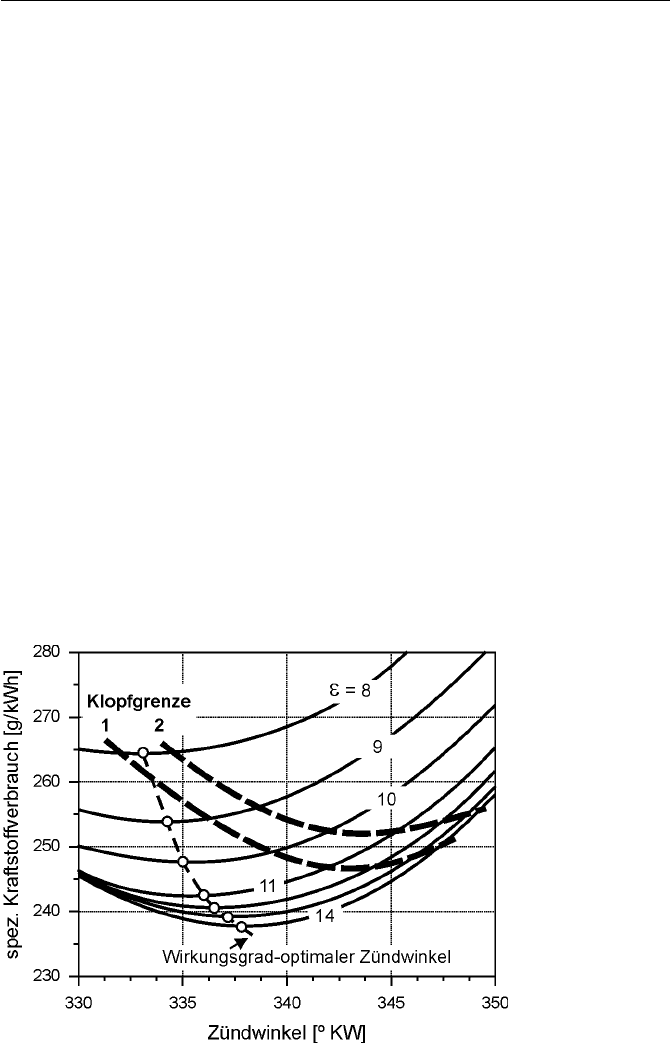
3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 99
klopfender Verbrennung. Durch reaktionskinetische Ansätze wird deutlich, dass
die zeitlichen Änderungen der Stoffmengenanteile reaktiver Spezies und damit die
Gefahr des Klopfens durch zunehmende Werte von Temperatur und Druck bzw.
Dichte beschleunigt werden. Daraus wird deutlich, dass erstrebenswerte motori-
sche Maßnahmen wie eine Anhebung des Liefergrades und der Verdichtung sowie
Aufladung unausweichlich mit einer intensivierten Reaktionsanregung verbunden
sind. Auch längere Verweilzeiten des Gemisches unter diesen Randbedingungen
fördern das Auftreten von Selbstzündungen im Endgas [KLE03, WIN03].
Wegen der beim Ottomotor bekannten, als zyklische Schwankungen bezeichne-
ten Arbeitsspielvariationen sind längst nicht alle aufeinander folgenden Zyklen in
gleicher Weise klopfgefährdet, sondern vor allem die Arbeitsspiele mit höheren
Spitzendrücken. Daher ist es nicht notwendig, das Auftreten von Selbstzündungen
grundsätzlich zu unterdrücken. Zu einem klopfenden Motorbetrieb kommt es erst
dann, wenn großräumige Endgasbereiche in sehr kurzer Zeit durch Selbstzündung
umgesetzt werden und dieses in vielen aufeinander folgenden Arbeitsspielen er-
folgt. Die Klopfgrenze ist demnach kein fester Wert, sondern wird durch die Häu-
figkeit von Selbstzündprozessen vom Motorenentwickler individuell festgelegt.
Grundsätzlich sollte der Klopfgrenzbereich mit dem Ziel eines hohen Wirkungs-
grades und hoher Mitteldrücke so weit wie möglich ausgenutzt werden.
Die Einflüsse von geometrischer Verdichtung und Zündwinkel auf das Klopf-
verhalten und den Kraftstoffverbrauch sollen im Folgenden anhand eines Otto-
Saugmotors veranschaulicht werden. Die Zusammenhänge gelten uneingeschränkt
auch für aufgeladene Motoren, wobei das Verdichtungsverhältnis hierbei weiter
abgesenkt werden muss. Abb. 3.24 zeigt die rechnerische Ermittlung der Klopf-
grenze für einen freisaugenden Vierventil-Ottomotor bei einer Drehzahl von 4.500
1/min und einem Luftverhältnis von
Ȝ = 1.
Abb. 3.24. Rechnerische Klopfgrenze bei Variation der Verdichtung [KLE00]
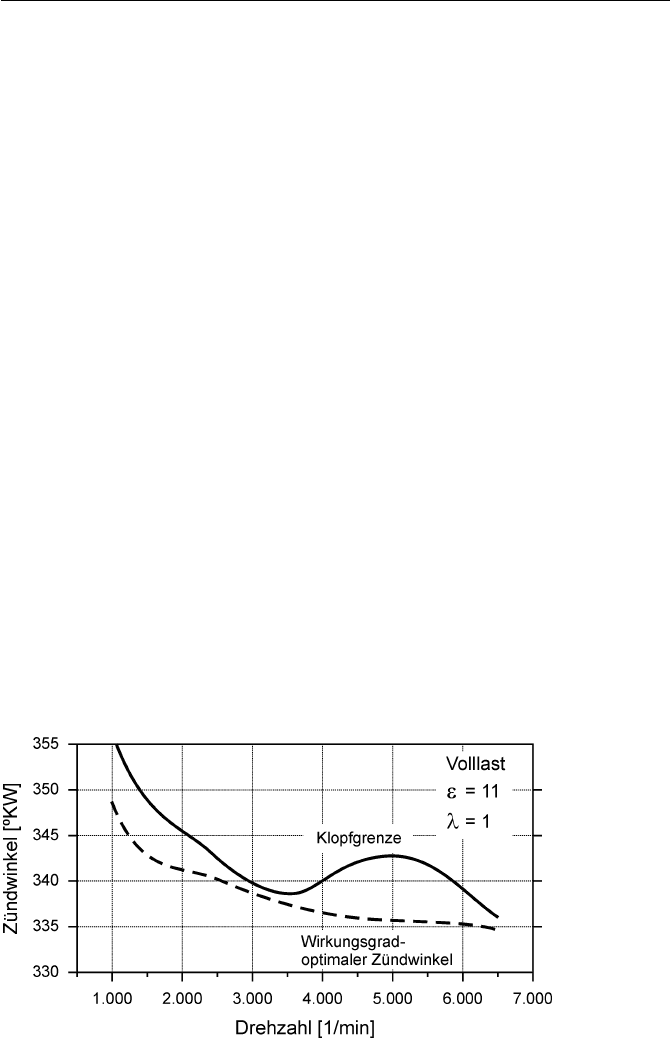
100 3 Downsizing
Für jedes Verdichtungsverhältnis gibt es genau einen wirkungsgradoptimalen
Zündwinkel, bei dem der spezifische Kraftstoffverbrauch minimal wird. Entspre-
chend der bekannten Zusammenhänge kann der spezifische Kraftstoffverbrauch
durch Anheben der geometrischen Verdichtung reduziert werden, wobei der
verbrauchsoptimale Zündzeitpunkt mit zunehmendem Verdichtungsverhältnis in
Richtung „spät“ wandert. Der Verlauf der Kurve „Klopfgrenze 1“ stellt nun den
frühesten Zündzeitpunkt dar, bei dem die infolge der zyklischen Schwankungen
resultierenden mittleren Zylinderdruckverläufe gerade noch klopffrei sein sollten.
Bei dieser „scharfen“ Klopfgrenze werden also einige Selbstzündungen in der
Ausbrandphase zugelassen, die in ihrer Gesamtheit jedoch noch nicht zum Klop-
fen führen. Aus dem Verlauf der „Klopfgrenze 1“ ist zu erkennen, dass der Motor
nur für ein Verdichtungsverhältnis von
İ = 8 wirkungsgradoptimal betrieben wer-
den kann. Für höhere Verdichtungsverhältnisse muss der Zündzeitpunkt in Rich-
tung „spät“ verschoben werden, um Klopfen zu vermeiden.
Durch Einstellung der Zündzeitpunkte nach „Klopfgrenze 2“ wird das Phäno-
men Klopfen ganz sicher ausgeschlossen. Sämtliche Zyklen laufen hiernach voll-
ständig ohne Selbstzündungserscheinungen ab. Verbunden ist dieser Motorbetrieb
jedoch mit spürbaren Wirkungsgradeinbußen. Selbst bei einem Verdichtungsver-
hältnis von
İ = 8 kann der Motor nach dieser Abstimmung nicht mehr wirkungs-
gradoptimal betrieben werden. Hier wird deutlich, dass es aus Verbrauchsgründen
durchaus vorteilhaft ist, möglichst in den selbstzündungsbehafteten (jedoch klopf-
freien) Betrieb hineinzufahren. In dem Diagramm ist zudem zu erkennen, dass die
Wirkungsgradvorteile mit zunehmendem Verdichtungsverhältnis und unter Be-
rücksichtigung der Klopfgrenze immer geringer ausfallen. Bei geometrischen
Verdichtungen über 12 kann der Kraftstoffverbrauch sogar wieder leicht anstei-
gen, da sehr späte Zündwinkel gefahren werden müssen. Hinsichtlich des Voll-
lastverhaltens ist es daher durchaus zielführend, zur Klopfbegrenzung eine Ver-
dichtungsabsenkung gegenüber einer Spätverstellung des Zündwinkels den Vor-
zug zu geben. Das Klopfverhalten ist grundsätzlich auch drehzahlabhängig, wie
der Volllastbetriebspunkt in Abb. 3.25 erkennen lässt.
Abb. 3.25. Zündwinkel bei Volllast [KLE03]
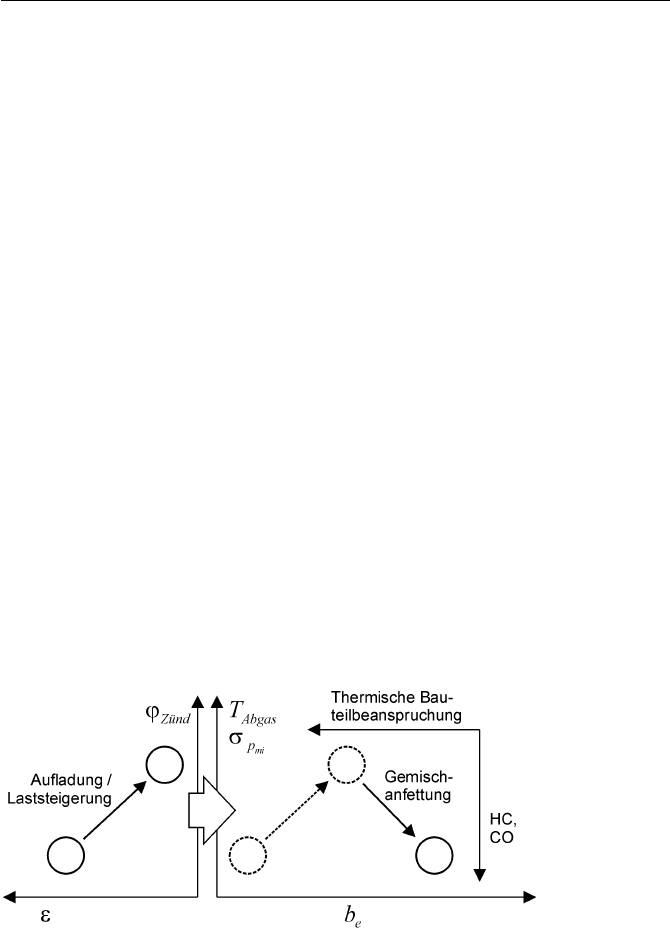
3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 101
Die erforderliche Zündwinkeleinstellung ist hier entlang des gesamten Dreh-
zahlbandes klopfbegrenzt, wobei bei niedrigsten Drehzahlen und Drehzahlen im
oberen Bereich die Verbrauchsnachteile – dargestellt durch den Abstand der bei-
den Kurven – besonders groß sind. Als Begründung für dieses Verhalten lässt sich
anführen, dass die Verweildauer des unverbrannten Frischgemisches bei niedrigen
Drehzahlen entsprechend groß ist, wodurch die Gefahr der Selbstzündung beson-
ders ausgeprägt ist. Zu größeren Drehzahlen schwächt sich dieser Effekt ab, so-
dass der Abstand zum verbrauchsoptimalen Zündwinkel zunehmend kleiner wird.
Ab einer Drehzahl von etwa 3.500 1/min nimmt die Klopfgefahr wieder stark zu,
erreicht bei etwa 5.000 1/min ihr Maximum und erfordert eine deutliche Verstel-
lung des Zündwinkels in Richtung „spät“. Die Gründe hierfür sind zum einen eine
durch besonders vorteilhafte dynamische Saugrohreffekte gestiegene Ladungs-
dichte und zum anderen eine mit der Drehzahl ansteigende Abgastemperatur, die
über die Restgasvermischung auch zu erhöhten Gemischtemperaturen führt. Bei
höchsten Drehzahlen wird schließlich die für den Ablauf der Vorreaktionen zur
Verfügung stehende Zeit so gering, dass die Klopfgefahr verschwindet.
Ein weiterer, grundsätzlicher Nachteil klopfbedingter, später Zündzeitpunkte
sind damit verbundene Drehmomentschwankungen. Diese können speziell bei
hubraumkleinen Motoren mit geringer Zylinderzahl auftreten, sind umso stärker,
je weiter der Zündwinkel vom Optimum entfernt ist und je steiler die Zündhaken
verlaufen, was insbesondere bei hohen Ladedrücken der Fall ist. Verursacht wer-
den die Drehmomentschwankungen durch die bei späten Verbrennungsschwer-
punktlagen zu beobachtenden starken zyklischen Schwankungen im Verbren-
nungsablauf, die sich in einem Anstieg der Standardabweichung des indizierten
Mitteldruckes manifestieren [HAB00].
In Abb. 3.26 sind die mit der Klopfproblematik beim Ottomotor verbundenen
Auswirkungen auf Kennwerte und Prozessgrößen noch einmal schematisiert zu-
sammengefasst.
Abb. 3.26. Die Klopfproblematik beim Ottomotor
Mit der Aufladung ist in der Regel eine Absenkung des Verdichtungsverhält-
nisses verbunden. Da das Verdichtungsverhältnis im Interesse hoher Teillastwir-
kungsgrade auf relativ hohem Niveau ausgelegt wird, muss der Klopfneigung
vermehrt durch späte Zündung begegnet werden, die ihrerseits zu einer Begren-

102 3 Downsizing
zung der Spitzentemperatur und des maximalen Zylinderdruckes führt. Die Spät-
verstellung der Zündung ist aufgrund der vom oberen Totpunkt weiter entfernten
Energieumsetzung jedoch mit einer Steigerung des Kraftstoffverbrauchs und der
Abgastemperatur verbunden. Die höhere Abgastemperatur bewirkt eine zuneh-
mende, thermische Beanspruchung der abgasführenden Motorkomponenten (z.B.
Auslassventile, Abgasturbine und Katalysator), sodass zum thermischen Bauteil-
schutz eine Gemischanreicherung nötig ist, die zusätzlich den Verbrauch sowie
die CO- und HC-Emissionen erhöht. Darüber hinaus resultiert aus der späten
Verbrennungslage eine geringe Verbrennungsstabilität, die zu einer Zunahme der
zyklischen Schwankungen führt und damit den Fahrkomfort beeinträchtigt.
3.4.3 Thermische und mechanische Motorbelastung
Mit steigenden Mitteldrücken werden, bezogen auf das Zylinderhubvolumen,
zunehmend größere Energiemengen umgesetzt. Trotz einer damit verbundenen
Wirkungsgradsteigerung sind größere absolute Wärmemengen über das Kühlwas-
ser und das Abgas abzuführen. Die Umsetzung eines Downsizing-Konzeptes er-
fordert daher stets eine Anpassung des Kühlkreislaufes sowie der Abgasanlage.
Hohe Wärmestromdichten wirken auf die Bauteile ein, welche direkten Kontakt
mit den heißen Brenngasen haben. Es sind dies der Zylinderkopf, der Kolben und
die Zylinderlaufbuchse. Mit zunehmenden Mitteldrücken kommt es in erster Nä-
herung zu einem linearen Anstieg der Bauteiltemperaturen, sodass geeignete
Maßnahmen zur Kühlung getroffen werden müssen. Im Zusammenhang mit der
Modifikation des Brennverfahrens treten darüber hinaus steigende thermische und
mechanische Belastungen innerhalb des Motors auf. Die aus Verbrauchsgründen
notwendige Steigerung des Zünddruckes ist mit einer Anhebung der maximalen
Prozess- und Wandtemperaturen verbunden, sofern gleiche Luftverhältnisse vor-
ausgesetzt werden. Insbesondere der Zünd- oder Spitzendruck gilt als Maß für die
mechanische Triebwerksbelastung, wobei zur Darstellung hoher Mitteldrücke der
Zylinderdruck auch über einen längeren Kurbelwinkel- bzw. Zeitbereich auf ho-
hem Niveau verbleibt und zu einer längeren Wirkdauer der Triebwerkskräfte
führt. Damit ist die Anpassung der folgenden Bauteile und Baugruppen nötig:
x Kurbelgehäuse
x Zylinderkopf, -dichtung und Ventile
x Kolben
x Haupt- und Pleuellager
x Kurbelwelle
x Ölkreislauf
Bei Downsizing-Konzepten mit sehr hoher Leistungsdichte und hohen Mittel-
drücken reichen Anpassungen bestehender Motoren nicht mehr aus, sodass die
o.g. Komponenten und Baugruppen einer kompletten Neuentwicklung bedürfen.
Hierbei ist auch die Verwendung höher belastbarer Werkstoffe sowie geeigneter
Oberflächenbeschichtungen und Oberflächenbehandlungen erforderlich, um den
Beanspruchungen dauerhaft Stand halten zu können. Konsequentes Downsizing

3.4 Problembereiche hochaufgeladener Motoren 103
führt daher trotz geringerer Motorabmaße und ggf. geringerer Zylinderzahlen stets
zu höheren Kosten, insbesondere wenn der Einsatz zusätzlicher Technologien zur
Verbesserung des Betriebsverhaltens nötig ist.
Beim Dieselmotor, der nicht durch die Klopfproblematik beschränkt ist, ergibt
sich die Aufladefähigkeit aus dem Zusammenhang von Ladedruck und Spitzen-
druck. Infolge der bei höheren Ladedrücken zur Beherrschung der mechanischen
Belastungen erforderlichen Absenkung des Verdichtungsverhältnisses steigt der
Spitzendruck degressiv an. Damit ist beim Dieselmotor ein Trend zu steigenden
Abgastemperaturen zu beobachten, der zwar die Abgasturbine höher belastet, aber
hinsichtlich Abgasenthalpie zur Darstellung hoher Ladedrücke durchaus positiv
bewertet werden kann.
Ein anderer Trend ist beim Ottomotor zu beobachten. Für sehr hohe Ladedrü-
cke ist eine deutliche Klopfbegrenzung nötig, die einerseits auf dem Wege einer
Verdichtungsabsenkung und andererseits über eine Spätverstellung der Zündung
erfolgt und damit – trotz steigender Ladedrücke – durchaus zu sinkenden Spitzen-
drücken führen kann [HAB00].
3.4.4 Akustik und Schwingungskomfort
Der Motorakustik und dem Schwingungskomfort wird insbesondere im Pkw-
Segment ein großer Stellenwert eingeräumt. Bei anderen Anwendungen stehen
diese Merkmale eher im Hintergrund, wenngleich das Schwingungsverhalten bei
Großmotoren in Bezug auf die Fundamentierung und die Gestaltfestigkeit des
Antriebssystems eine durchaus wichtige Eigenschaft darstellt.
Die bei konsequentem Downsizing erforderliche Reduzierung der Zylinderzahl
– z.B. der Sprung vom 8-Zylinder- auf einen 6-Zylinder-Motor, vom 6- zum 4-
Zylinder-Motor oder vom 4- zum 3-Zylinderaggregat – wird vom Kunden insbe-
sondere im Pkw-Segment mit einer Verschlechterung der Akustik verbunden.
Während dieses Empfinden subjektiver Natur ist, bestehen dagegen hinsichtlich
Laufruhe und Schwingungskomfort durchaus Beeinträchtigungen, denen – wo es
der Markt erfordert – mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden muss.
Ein Problem speziell hubraumkleiner und hochaufgeladener Ottomotoren mit
geringer Zylinderzahl ist die Gefahr von Drehmomentschwankungen, die sich im
Fahrbetrieb unangenehm bemerkbar machen. Diese Schwankungen resultieren aus
der mit der Klopfbegrenzung verbundenen Spätverstellung des Zündzeitpunktes.
Infolge der damit verbundenen Verschiebung des Verbrennungsschwerpunktes
nach spät nehmen die Schwankungen im indizierten Mitteldruck zu und führen
damit unmittelbar zu einer unstetigen Drehmomentabgabe. Abhilfe kann hier nur
die Absenkung des Verdichtungsverhältnisses mit dem Ziel einer wirkungsgrad-
steigernden Schwerpunktlage der Verbrennung schaffen. Diese Maßnahme führt
jedoch zu einem Anstieg der Abgastemperatur und erfordert zum thermischen
Bauteilschutz im Volllastbereich eine Gemischanreicherung, sodass der Kraft-
stoffverbrauch negativ beeinflusst wird.
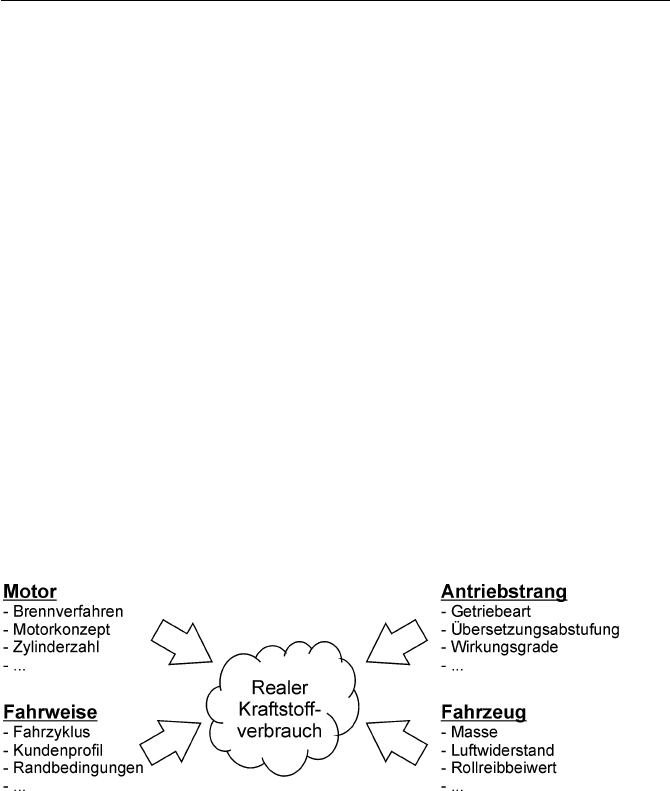
104 3 Downsizing
3.5 Verbrauchspotenziale
Die Notwendigkeit zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei Verbrennungsmoto-
ren wird sowohl durch den Kunden selbst als auch durch die Selbstverpflichtung
der Automobilindustrie getrieben. Nicht zuletzt die in den letzten Jahren stark
angestiegenen Kosten für Rohöl und dem damit verbundenen, nachteiligen Ein-
fluss auf die Weltwirtschaft lassen diese Forderung zunehmend wichtiger erschei-
nen. In einigen Ländern, darunter auch Deutschland, wird der Kraftstoff darüber
hinaus hoch besteuert. Downsizing in Verbindung mit Aufladung zur Darstellung
von motorischen Hochlast-Konzepten kann zur Senkung der CO
2
-Emission einen
wesentlichen Beitrag leisten. Der vorliegende Abschnitt soll helfen, die durch
Downsizing möglichen Verbrauchspotenziale zu quantifizieren.
3.5.1 Einflussparameter und Verbrauchsszenarien
Generell hängt der Kraftstoffverbrauch von Antriebssystemen neben dem Motor
selbst auch von weiteren Einflussgrößen ab. Das komplexeste System stellt dabei
sicherlich der Einsatz des Motors im Fahrzeug dar, wo ein relativ großer Last-
Drehzahl-Bereich ausgenutzt wird und die instationäre Motorcharakteristik von
großer Bedeutung ist. Bei dieser Anwendung spielen hinsichtlich des realen Kraft-
stoffverbrauchs die Fahrweise, das verwendete Fahrzeug sowie der Antriebstrang
eine wesentliche Rolle, siehe Abb. 3.27.
Abb. 3.27. Einflussgrößen auf den Kraftstoffverbrauch von Motoren im Fahrzeugeinsatz
Das Fahrprofil gibt die Fahrgeschwindigkeit als Funktion der Zeit vor. In Ab-
hängigkeit der Fahrzeugeigenschaften werden die Fahrwiderstände (Rollwider-
stand, Luftwiderstand, Beschleunigungswiderstand, Steigungswiderstand) und
damit die erforderliche Antriebsleistungen ermittelt. Der Raddurchmesser be-
stimmt dann die jeweilige Raddrehzahl sowie das am Rad benötigte Drehmoment.
Über die Wirkungsgrade des Antriebstranges sowie die Getriebeübersetzung er-
gibt sich daraus die vom Motor bereit zu stellende Antriebsleistung in Form des
Drehmomentes und der Drehzahl. Aus dem Drehmoment und dem Motorhubvo-
lumen kann schließlich der erforderliche effektive Mitteldruck berechnet werden.
