Kaltschmitt M. und and. Biogasgewinnung und -nutzung
Подождите немного. Документ загружается.

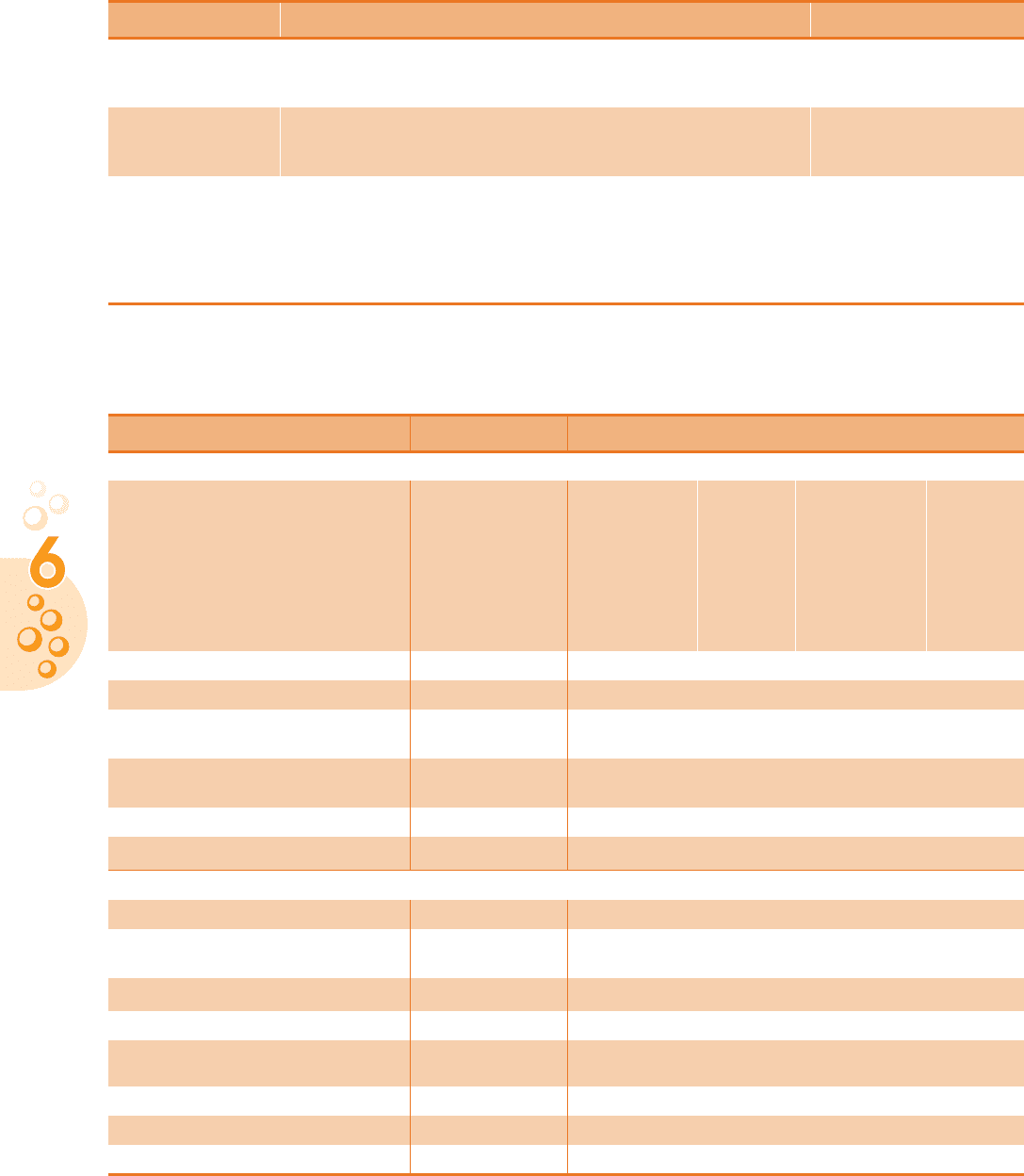
Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung
120
Tabelle 6-4: Einteilung der Leistungsklassen der Modellanlagen
Leistungsklasse Begründung Modellanlagen-Nr.
d 70 kW • Bis 70 kW: Teilschulderlass der KfW im Rahmen des MAP
• Beispiel für niedrigen Leistungsbereich
• Mindestgrundvergütung 11,5 Cent pro Kilowattstunde
a
1
70 – 150 kW • Beispiel für den durchschnittlichen Leistungsbereich derzeit
überwiegend gebauter Anlagen
• Mindestgrundvergütung 11,5 Cent pro Kilowattstunde
a
2
3
150 – 500 kW • Beispiele für landwirtschaftliche Großanlagen und Gemeinschafts-
anlagen
• Kostendegressionseffekt in Bezug auf die Höhe der spezifischen
Investition
• Anteilige Mindestgrundvergütung von 11,5 Cent und 9,9 Cent pro Kilowatt-
stunde
a
4
5
6
a. Entwurf zur Novellierung EEG vom 18.11.03 (siehe Kapitel 10)
Tabelle 6-5: Technische und verfahrenstechnische Parameter der Modellanlagen
Parameter / Annahmen Einheit Größenordnung
BHKW
Wirkungsgrad BHKW
el./therm
bei ... installierten elektr. kW:
... 50
51 - 75
76 – 150
151 - 200
201 - 330
331 – 500
[%]
elektrisch
Herstellerangaben
33
35
36
37
39
40
elektrisch
Dauerbetrieb
30
32
33
34
35
36
therm.
Herstellerangaben
50
49
48
47
50
53
therm.
Dauerbetrieb
40
39
38
38
40
43
Sicherheitszuschlag BHKW-Leistung [%] ---
BHKW-Laufzeit
(Volllastanteil: 100%)
[h/Jahr] 8.000
BHKW-Bauart ab 250 kW errechnete Leistung aus Methan:
Gas-Otto-Motor
Zündölanteil bei Zündstrahlmotor [%] 10,0
Heizwert Methan
kWh/m
3
10,0
Verfahrenstechnik
Gaslagerkapazität [h/Tag] mindestens 5
Pumpfähigkeit des Substratgemisches
TS t 16%: Zusatzmodul Feststoffeintrag
[% TS] max. 16
Faulraumbelastung
[kg oTS/m
3
· Tag]
max. 3,5
Verweilzeit im Fermenter [Tage] mindestens 30
Bruttovolumen Fermenter
[m
3
]
Nettovolumen + 10%
Nettovolumen: (Substratmenge pro Tag x Verweilzeit)
Lagerkapazität Gärrest [Tage] 180
Gärtemperatur [°C] Mesophil: 38
Mittlere Substratzulauftemperatur [°C] 12
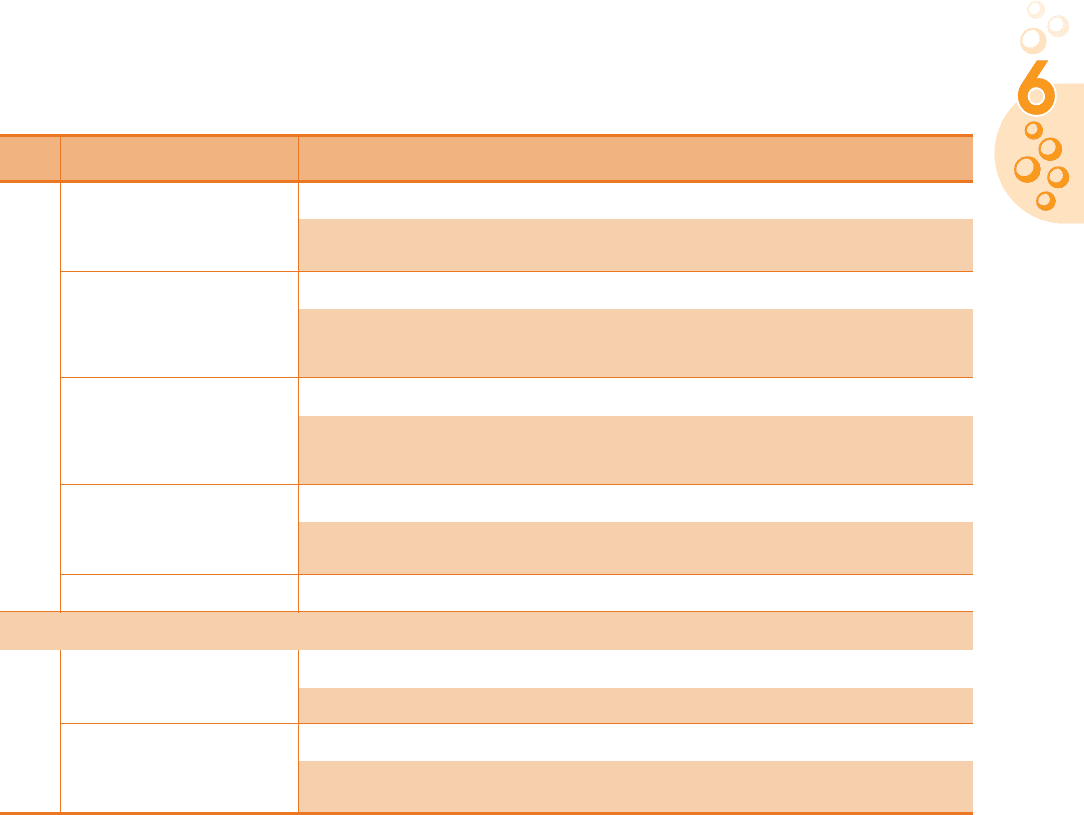
Modellanlagen
121
6.2.3 Biologische und technische Auslegung
6.2.3.1 Biologische/verfahrenstechnische Parameter
Für einen betriebssicheren Fermentationsprozess und
eine wirtschaftlich realistische Einschätzung einer
Anlage ist die Definition grundlegender, den Fermen-
tations- und Gasverwertungsprozess beeinflussender
Parameter mit Darlegung der Größenordnung unab-
dingbar. Einen Überblick über diese Parameter der
biologischen und (verfahrens-)technischen Auslegung
der Modellanlagen gibt Tabelle 6-5.
6.2.3.2 Bauliche/technische Parameter
Die technische Ausstattung der Modellanlagen wird
in Bauteile gegliedert und diese zu funktionalen Bau-
gruppen zusammengefasst (vgl. Kapitel 3 und 5).
Baugruppen
Bei der technischen Auslegung und Konfiguration der
Modellanlagen wurde festgelegt, dass alle Modelle
der gleichen einstufigen Prozessführung unterliegen.
Weiterhin sind alle verwendeten Bauteile von ver-
gleichbarer Ausstattung, auch in der Auswahl der
Materialien, sie unterscheiden sich ggf. hinsichtlich
ihrer Dimensionierung. Die verwendeten Baugrup-
pen sind in Tabelle 6-6 aufgeführt und charakterisiert.
Die Darstellung der Haupt-Bauteile innerhalb einer
Baugruppe soll die Funktionseinheit des Systems
verdeutlichen. Eine Untergliederung in Basis- und
Zusatzausstattung unterstreicht, dass bei der Ver-
wertung von TS-reichen Materialien oder betriebs-
fremden Kosubstraten neben Kapazitätserweiterun-
gen der Basisausstattung Zusatzausstattungen an der
Anlage erforderlich sind, die Einfluss auf den Mecha-
nisierungsgrad, den Investitionsbedarf und damit auf
den Gesamtbetrieb der Anlage und deren Kosten ha-
ben.
Tabelle 6-6: Für die Modelle verwendete Baugruppen mit Charakterisierung
Baugruppe Charakterisierung und Haupt-Bauteile
BASISAUSSTATTUNG
Annahme Gülle/Kofermente Betonbehälter, ggf. Vorratstank
Rühr-, Zerkleinerungs-, und Pumptechnik, evtl. Befüllschacht, Substratleitungen, Füllstandsmessung,
Leckerkennung, Volumenmeßgeräte
Fermenter Oberirdisch errichteter, stehender Betonbehälter
Beheizung, Isolierung, Verkleidung, Rührtechnik, gasdichte Behälterabdeckung (Gaslagerung), Sub-
strat- und Gasleitungen, biologische Entschwefelung, Mess- und Regel- sowie Sicherheitstechnik, Leck-
erkennung
BHKW Zündstrahl- oder Gas-Otto-Motor
Motorblock, Generator, Wärmetauscher, Wärmeverteiler, Notkühler, Steuerung, Gasleitungen, Mess-
und Regel- sowie Sicherheitstechnik, Wärmemengen-, Stromzähler, Sensorik, Kondensatabtrennung,
Druckluftstation, ggf. zusätzliche Gastechnik, Ölbehälter, Schallschutz, Container
Gärrestlager Betonbehälter
Rührtechnik, Substratleitungen, Entnahmetechnik, Behälterabdeckung, Leckerkennung
(bei gasdichter Behälterabdeckung: Mess- und Regeltechnik, Sensorik, Gasleitungen)
Gasfackel Einfache Bauausführung, zusätzliche Gastechnik
Notwendigkeit der Ausstattung resultiert aus Substrateigenschaften/-herkunft
ZUSATZ-
AUSSTATTUNG
Feststoffeintrag Schnecken- oder Presskolbeneintrag
Befülltrichter, Wiegeeinrichtung, Fermenterbeschickung
Hygienisierung Chargenhygienisierung vor Fermentationsprozess
Isolierter Behälter, Beheizung, Rühr-, ggf. Zerkleinerungs- und Pumptechnik, Mess- und Regeltechnik,
Sensorik
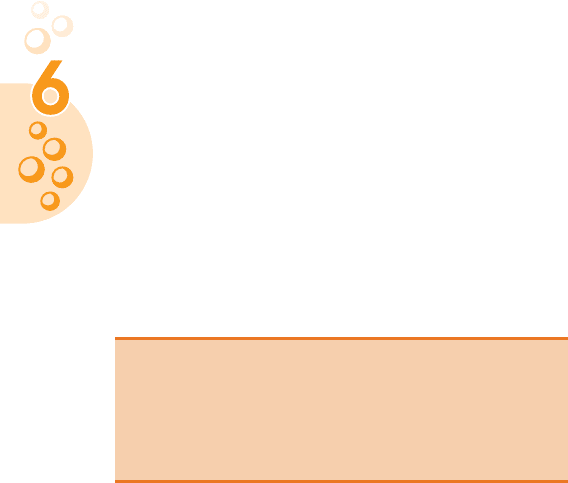
Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung
122
6.2.4 Annahmen für die Investitionsbedarfs-
berechnung
6.2.4.1 Investitionsbedarf Baugruppen
Eine Übersicht über den Investitionsbedarf für die
Baugruppen-Ausstattung der Modellanlagen gibt Ta-
belle 6-16, Kapitel 6.3.3. Die Preise umfassen Material-
und Montagekosten.
Hinsichtlich der Kostenermittlung für die Bau-
gruppen „Gärrestlager“, „Feststoffeintrag“ und
„Hygienisierung“ sind folgende Annahmen getroffen
worden:
Gärrestlager
Bei Modellanlagen mit einzelbetrieblicher Organisa-
tionsform wird nur die zusätzliche Lagerkapazität
durch den Kofermenteinsatz berechnet, da die Kosten
der Wirtschaftsdüngerlagerung der Tierhaltung anzu-
rechnen sind.
Bei Modellanlagen, die als Gemeinschaftsanlagen
konzipiert sind und an dem Ort errichtet werden, an
dem auch die Tierhaltung angesiedelt ist, ist nur die
zusätzliche Investition durch Kosubstratlagerung kal-
kuliert. Am Biogasstandort anfallender Wirtschafts-
dünger sowie Wirtschaftsdünger anderer an der
Gemeinschaft beteiligter Betriebe wird nicht in die
Lagerkapazitätsberechnung aufgenommen. Weiter-
hin wird bei der Berechnung des zusätzlichen Lager-
kapazitätsbedarfes ein Abbaugrad der organischen
Trockensubstanz der Kofermente in Höhe von 50 %
unterstellt.
Feststoffeintragstechnik
Die Feststoffeintragstechnik wird benötigt, wenn
trockensubstanzreiche Materialien in einer Größen-
ordnung eingesetzt werden, bei der
- bei einer Einmischung in eine Vorgrube die Pump-
fähigkeit des Substratgemisches überschritten
würde (Grenze der Pumpfähigkeit: 16 % TS).
- bei einem Anmaischen in einem Annahmebehälter
mit extremen Schwimm- oder Sinkschichten
gerechnet werden müsste.
Die Dimensionierung und damit der Investitionsbe-
darf für den Feststoffeintrag ist somit von der
Menge/Substratcharge trockensubstanzreichen Mate-
rials abhängig.
Hygienisierung
Der Verfahrensablauf der Modellanlagen sieht einen
Hygienisierungsprozess vor der Fermentationsstufe
vor, d. h. es werden nur die Substratchargen hygieni-
siert, die nach der EU-HygieneV 1774/2002 (s. Kapitel
7) oder nach BioAbfV (s. Kapitel 7) hygienisierungs-
pflichtig sind.
Die Kosten der Baugruppe „Hygienisierung“ sind
abhängig von ihrer Dimensionierung, d. h. von der
Menge des Tagesdurchsatzes des zu hygienisierenden
Materials.
Falls hygienisierungspflichtiges Material bereits
hygienisiert an die Biogasanlage angeliefert wird, so
ist keine Hygienisierungsvorrichtung an der Biogas-
anlage notwendig, die Kosten dafür brauchen dem-
nach nicht angesetzt werden. Womöglich ist aber eine
Anpassung der Rohstoffkosten/-erlöse für dieses
Substrat vorzunehmen, da die Kosten, die eine
externe Hygienisierung verursacht, im Normalfall auf
die Entsorgungskosten oder -erlöse des Materials
pro t Frischmasse umgelegt werden.
6.2.4.2 Investitionsbedarf Modellanlagen
Für die Modellanlagen wurde bei der Ermittlung des
mittleren Investitionsbedarfes von weitgehend opti-
malen Bedingungen ausgegangen, d. h.:
- Es sind keine Ausgaben für spezielle oder außerge-
wöhnliche Baubedingungen erforderlich.
- Wie für andere landwirtschaftliche Bauvorhaben
auch, sind Kosten für Bauplatz und Erschließung
nicht gesondert berücksichtigt. Bei gewerblichen
Anlagen und Gemeinschaftsanlagen müssen diese
Kostenpositionen möglicherweise zusätzlich in die
Kalkulation einfließen.
- Bei der Auslegung der Modellanlagen wurde gene-
rell darauf geachtet, dass die installierten Leistungen
der BHKW genau auf die unterstellten Substratmen-
gen und Gaserträge abgestellt sind. Dabei wurde
von einer optimalen Laufzeit des eingesetzten
BHKW von 8.000 Betriebsstunden im Jahr bei
100 % Volllast ausgegangen. Die Rest-Standzeit von
760 Stunden pro Jahr beinhaltet Wartungs- und klei-
nere Reparaturintervalle (vgl. Kapitel 9). Längere
Standzeiten des Motors als 2 bis 3 Tage am Stück
sollten u.a. aus verfahrenstechnischen und ökonomi-
schen Gründen unbedingt vermieden werden.
In der Praxis dagegen werden sehr häufig Leistungs-
reserven vorgehalten, die durch den Gedanken einer
Güllelagerraum unter dem Stall ist weder als Gär-
restlagerkapazität noch als Lagerraum für den Fer-
mentationsprozess in ein Anlagenkonzept zu inte-
grieren. Er ist allenfalls als zusätzlicher Puffer für
die Vorgrube/den Anmischbehälter zu nutzen.
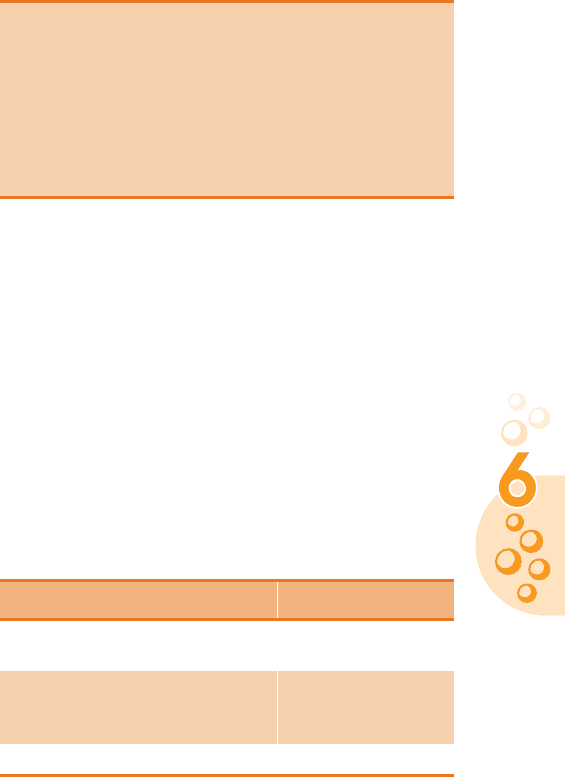
Modellanlagen
123
möglichen Anlagenerweiterung begründet werden.
Dies kann aber nur dann wirtschaftlich sinnvoll sein,
wenn die Reserven in überschaubarer Zeit genutzt
werden können, d. h. wenn mit zusätzlichen Substra-
ten verlässlich kalkuliert werden kann. Das Vorhalten
von Kapazitäten kostet viel Geld!
Eine weitere Möglichkeit, dem Erweiterungsge-
danken ohne viel Umrüstungsaufwand Rechnung zu
tragen, ist die Vorhaltung von Platzreserven z. B. im
Technikcontainer oder Technikgebäude für einen wei-
teren Motor. Die Vorhaltung von Platzreserven in die-
ser Form ist kostenseitig sehr viel günstiger als die
Vorhaltung von Leistungskapazitäten bei einem
bereits genutzten Motor.
Die Kostenposition „Vorhaltung von Platzreserven
und zusätzliche Anschlüsse für weiteren Motor“ ist
bei der Investitionsberechnung für die Modellanlagen
nicht berücksichtigt worden.
Parameter und Annahmen, die für weitergehende
wirtschaftliche Analysen der Modellanlagen ausge-
wählt und getroffen werden müssen, sind ausführlich
in Kapitel 10 vorgestellt und behandelt.
6.2.5 Betrieb der Modellanlagen
Bei der Planung von Biogasanlagen stehen Landwirte
vor der Entscheidung, eine Biogasanlage einzelbe-
trieblich oder gemeinschaftlich mit einem oder meh-
reren Landwirten zu betreiben. An die unterschiedli-
chen Möglichkeiten der Kooperationsform von
Gemeinschaftsanlagen, die an die Situation vor Ort
angepasst werden muss, sind bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft (siehe Kapitel 9). Weiterhin müs-
sen z. B. rechtliche und steuerrechtliche Fragestellun-
gen geklärt und die Konsequenzen hinsichtlich der
für den Komplex „Biogaserzeugung, Anlagenerrich-
tung und -betrieb“ geltenden Gesetze berücksichtigt
werden. Genehmigungsrechtliche Aspekte von
Gemeinschaftsanlagen werden ausführlich in Kapitel
7 angesprochen, eine Übersicht über mögliche Be-
triebsformen und sich daraus ergebende steuerrechtli-
che Konsequenzen gibt Kapitel 9.
Die Entscheidung für eine bestimmte Koopera-
tionsform sollte von langer Hand geplant werden und
unter Hinzuziehung einer sachkundigen Person
(unabhängiger Berater) erfolgen.
Für die Modellanlagen wird nur grundsätzlich
zwischen den Betreibermodellen „Einzelbetrieb“ und
„Gemeinschaftsbetrieb“ unterschieden.
Die Modellanlagen 1 und 2 werden einzelbetrieb-
lich betrieben; für Anlagen t 200 kW installierte elek-
trische Leistung ist als Betreiberlösung ein gemein-
schaftliches Konzept unterstellt worden. Das
Betriebskonzept der Gemeinschaftsbiogasanlage wird
in den Modellen 3, 5 und 6 berücksichtigt. Dabei wird
unter dem Begriff „landwirtschaftliche Gemein-
schaftsanlage“ Folgendes verstanden:
Modell 4 hingegen ist als Genossenschaftsanlage
eine Sonderform der landwirtschaftlichen Gemein-
schaftsanlage, da die landwirtschaftlichen Flächen der
Agrargenossenschaft als innerbetriebliche Flächen
behandelt werden. Die Zuordnung der Flächen ist
damit das wesentliche Unterscheidungskriterium zu
den o. a. definierten Gemeinschaftsanlagen.
Tabelle 6-7 bietet eine zusammenfassende Über-
sicht über die Betriebsform der Modellanlagen.
6.2.6 Genehmigung
Die Modellanlagen sollen hinsichtlich der formulier-
ten Charakteristika „Art und Menge Substrateinsatz“,
„Anlagenleistung“, „Betreibermodell für den Betrieb
der Anlage“ sowie „Gärrestverwertung“ eine reprä-
sentative Bandbreite an genehmigungsrelevanten Ge-
setzen erschließen.
Modellanlagen erlauben weiterhin die beispiel-
hafte Abbildung eines Genehmigungsprozesses.
Zudem kann über Synergie- oder Hemmeffekte ver-
schiedener gültiger Rechtsprechungen aufgeklärt
werden. Die einfache Strukturierung der Modellanla-
gen hinsichtlich Substrateinsatz, -menge und
Gemeinschaftsanlagen, bei denen sich mehrere
Landwirte zusammengeschlossen haben, um die in
ihren Betrieben anfallenden Wirtschaftsdünger und
weitere Kosubstrate zu behandeln und den Gärrest
auf den Flächen der Mitgliedsbetriebe zu verwerten,
sind als landwirtschaftliche Gemeinschaftsanla-
gen anzusehen.
Tabelle 6-7: Betriebsform der Modellanlagen
Betriebsform Modell-Nummer
Einzelbetrieb
1
2
Landwirtschaftliche Gemein-
schaftsanlage
(gemäß Definition im Text)
3
5
6
Genossenschaftsanlage 4
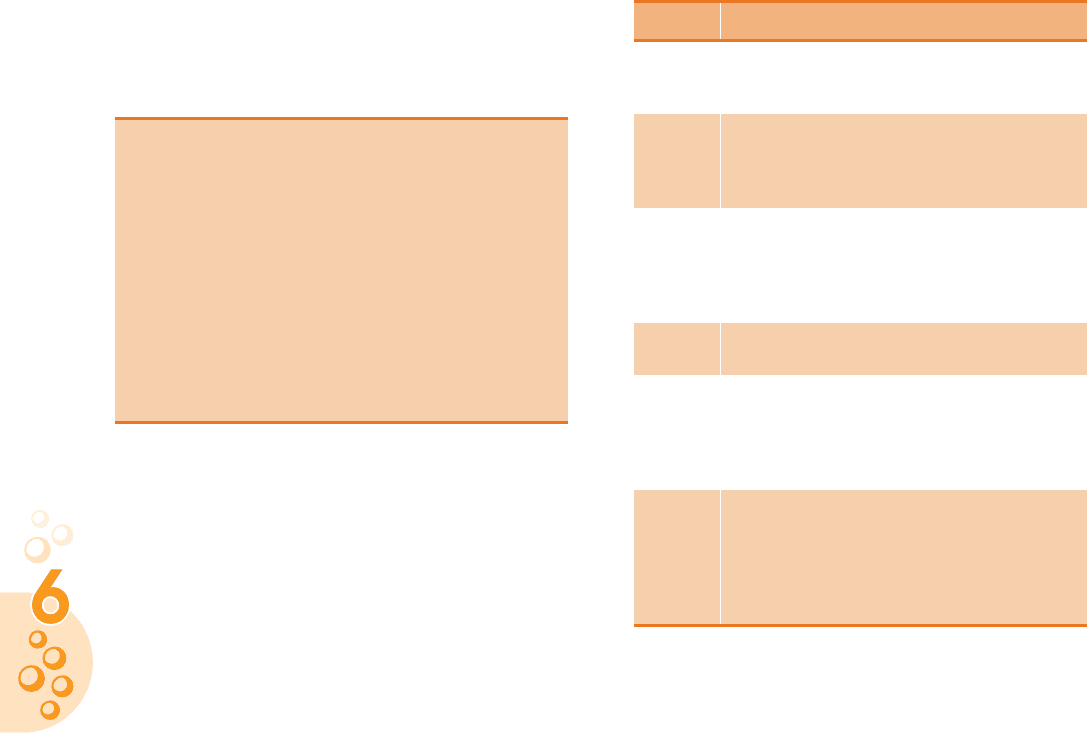
Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung
124
Mischungsverhältnis sowie Anlagengröße schließt
Sonderfälle der Genehmigung aus.
Eine ausführliche genehmigungsrechtliche Einord-
nung der Modellanlagen wird in Kapitel 7 vorgenom-
men.
6.3 Beschreibung und Darstellung
der Modellanlagen
Nachdem Eckdaten und Kennwerte von Biogasanla-
gen für den Modellbildungsprozess dargestellt und
definiert wurden, ist eine zusammenfassende und
übersichtliche Einordnung der Modellanlagen nach
praxisrelevanten Größen hilfreich (Tabelle 6-8)
Weiterhin ist zu betonen, dass die Modellanlagen
keine Abbildung konkreter Praxisanlagen sind. Sie
sind mit dem Ziel konzipiert worden, biologische,
verfahrenstechnische, genehmigungsrechtliche und
wirtschaftliche Gegebenheiten umfassend und praxis-
nah erklären und darstellen zu können, um den inter-
essierten Leser für immer wiederkehrende Kernfrage-
stellungen zu sensibilisieren und Lösungsvorschläge
aufzuzeigen.
Kapitel 6.3.1 gibt eine Übersicht über die sechs
konzipierten Modellanlagen mit Input- und Output-
bilanzen, Kapitel 6.3.2 gibt eine detaillierte Verfah-
rensbeschreibung und eine Übersicht über verwen-
dete Baugruppen sowie ihre Dimensionierung und
Auslegung für jede Modellbiogasanlage.
In Kapitel 6.3.3 wird der Investitionsbedarf für die
einzelnen, in Kapitel 6.3.2 näher beschriebenen und
die Modellanlagen betreffenden Baugruppen darge-
legt.
6.3.1 Input-Output-Übersicht der Modellanlagen
Tabelle 6-9 gibt eine Übersicht über die sechs konzi-
pierten Modellanlagen mit den dazugehörigen Input-
materialien und -chargen, den biologischen und ver-
fahrenstechnischen Kennwerten und Daten zum
Biogasertrag und zur Biogasverwertung.
6.3.2 Verfahrensbeschreibung der Modell-
anlagen
Eine Verfahrensbeschreibung gibt eine Übersicht über
verwendete Bauteile bzw. Baugruppen und ihre bau-
lich-technische Ausführung, um die Verfahrens-
schritte des Biogas- und Substratprozesses transpa-
renter zu gestalten.
In den Kapiteln 6.3.2.1 bis 6.3.2.5 werden die funk-
tionalen Baugruppen bzw. Verfahrensabschnitte der
Biogaserzeugung und –verwertung und des Substrat-
flusses allgemein beschrieben.
In Kapitel 6.3.2.6 werden die Spezifika der Bau-
gruppen der Modellanlagen dargelegt. Dabei wird
eine Dimensionierung für das Haupt-Bauteil der
Basis- sowie Zusatzausstattung vorgenommen. Die
sonstigen Bauteile, wie z. B. „Rührwerke“ oder „Pum-
pen“ sind so ausgelegt worden, dass ein reibungsloser
Hinweis:
Es ist dringend zu empfehlen, frühzeitig mit der ge-
nehmigenden Behörde Kontakt aufzunehmen und
abzuklären, welche Forderungen von Seiten der zu-
ständigen Behörde an den Landwirt oder die Ge-
meinschaft gestellt werden. Wie bei der sorgfältigen
Beratung und Planung einer Biogasanlage sind auch
mit der Genehmigung auf jeden Fall sachkundige
Personen zu betrauen; das können Mitarbeiter eines
erfahrenen Planungsbüro oder eines erfahrenen An-
lagenherstellers sein.
Tabelle 6-8: Charakteristika der Modellanlagen
Anlage Charakterisierung
Modell 1 Einzelbetrieblich organisierte Anlage mit Rin-
derhaltung 120 GV, ausschließlich Einsatz von
betriebseigenen NaWaRos (Mais-, Grassilage)
Modell 2 Einzelbetrieblich organisierte Anlage mit Mast-
schweinehaltung 160 GV, Einsatz von betriebsei-
genen (Maissilage, Roggen (Korn) 40%) und
zugekauften NaWaRos (Roggen, Korn)
Modell 3 Gemeinschaftsanlage mit Rinderhaltung
250 GV und Mastschweinehaltung 160 GV
sowie Einsatz von betriebseigenen NaWaRos
(Mais-, Grassilage, Roggen (Korn) 40%) und
zugekauften NaWaRos (Roggen, Korn)
Modell 4 Genossenschaftsanlage mit Rinderhaltung
2000 GV
Modell 5 Gemeinschaftsanlage mit Rinderhaltung
520 GV und Mastschweinehaltung 320 GV
sowie Einsatz von betriebseigenen NaWaRos
(Mais-, Grassilage, Roggen (Korn) 40%) und
zugekauften NaWaRos (Roggen, Korn)
Modell 6 Gemeinschaftsanlage mit 520 GV Rinderhal-
tung und 320 GV Mastschweinehaltung, Ein-
satz von betriebseigenen NaWaRos (Mais-,
Grassilage, Roggen (Korn) 40%) und zugekauf-
ten NaWaRos (Roggen, Korn), Einsatz von
Abfällen (Speisereste, Fettabscheider)
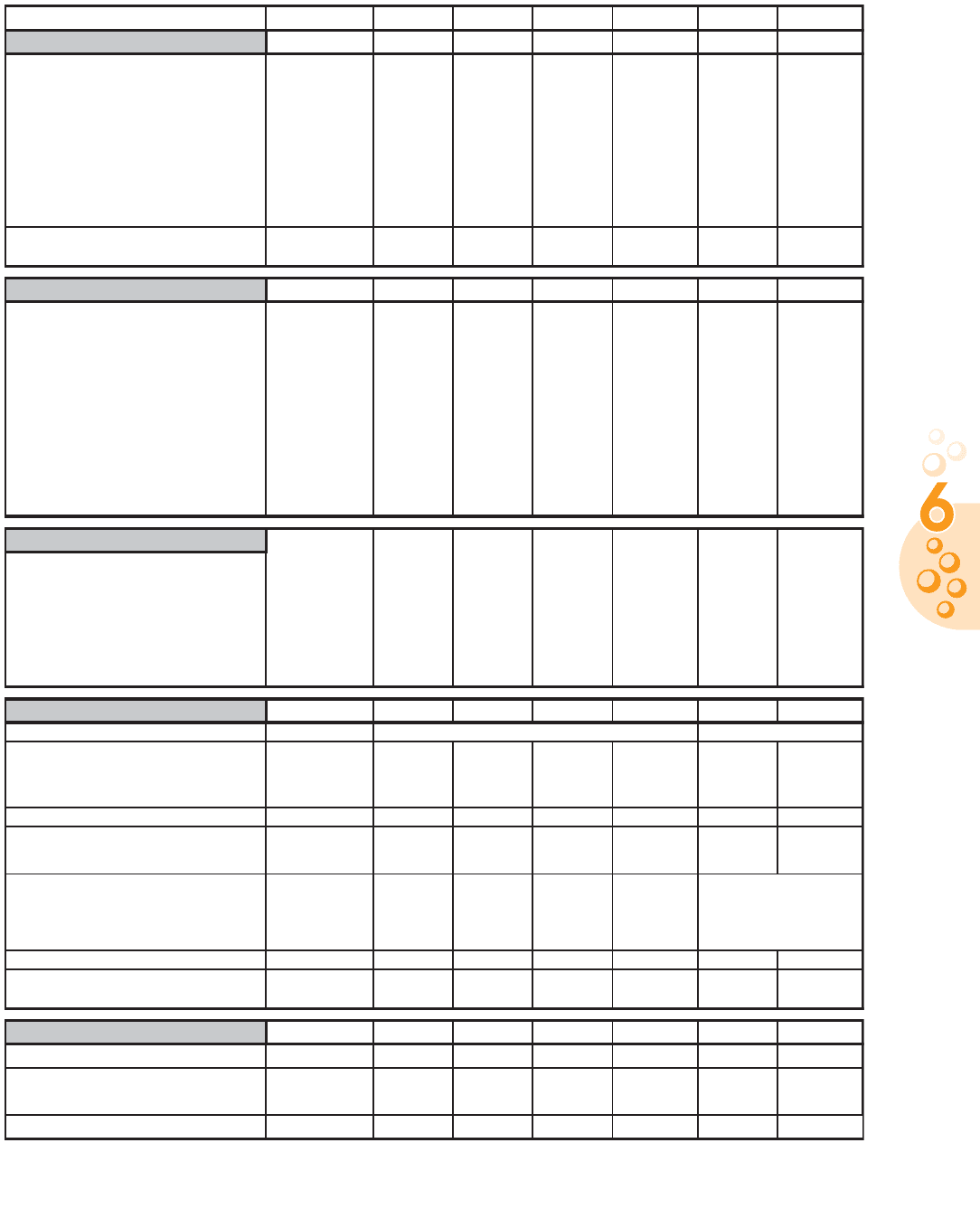
Modellanlagen
125
Tabelle 6-9: Modellanlagen – Inputsubstrate, biologische- und verfahrenstechnische Kennwerte sowie Biogaserträge und Daten
zur Verwertung
Kennwerte
Einheit Modell I Modell II Modell III Modell IV Modell V Modell VI
Substrate
Rindergülle
t FM/Jahr 2.160 4.536 36.000 9.360 9.360
Schweinegülle
t FM/Jahr 1.728 1.728 3.456 3.456
Futterreste
t/ FMJahr 22 46 365 95 95
Einstreu
t FM/Jahr 0
Maissilage
t FM/Jahr 600 600 1.000 2.500 1.700
Grassilage
t FM/Jahr 400 200 1.500
Roggen 40% Eigen; 60% Zukauf
t FM/Jahr 250 365 500 1500
Fettabscheiderfett
t FM/Jahr 1000
Speisereste
t FM/Jahr 3000
t FM/Jahr 3.182 2.578 7.875 36.365 17.411 20.111
t FM/Tag 8,7 7,1 21,6 99,6 47,7 55,1
Input
ø TS-Gehalt Inputmaterial
% 16,8 20,1 15,7 9,1 16,4 17,5
theoretischer ø Abbaugrad oTS
% 63,2 79,0 67,0 37,8 66,6 75,5
Verweilzeit
Tage 43 60 43 30 45 48
Gärbehältervolumen (netto)
m³ 375 424 928 2.999 2.147 2.645
Gärbehältervolumen (brutto)
m³ 420 480 1.100 3.300 2.400 3.000
Raumbelastung
kg oTS /m³
und Tag
3,2 2,9 3,0 2,3 3,0 3,1
Gärtemperatur
°C 38 38 38 38 38 38
Substratzulauftemperatur
°C 12 12 12 12 12 12
zusätzl. Gärrestlagerkapazität (ohne
Gülle)
m³ 410 270 530 0 1.700 2.770
Output
erwarteterGasertrag mN³/Jahr 233.490 295.681 578.634 823.160 1.319.724 1.919.534
erwarteter Methangehalt % 53,4 53,0 53,2 54,8 53,4 55,0
Ausfall der Gasproduktion Tage/Jahr 5 5 5555
Methanerzeugung mN³/Jahr 122.869 154.649 303.585 445.311 695.010 1.040.840
Methanerzeugung mN³/Tag 337 424 832 1220 1904 2852
Heizwert
kWh/mN³101010101010
Bruttoenergie im Biogas
kWh/Jahr
1.228.689 1.546.488 3.035.848 4.453.107 6.950.103 10.408.399
BHKW
Bauart
Wirkungsgrad
el
lt. Hersteller
% 333536373940
Wirkungsgrad
therm
lt. Hersteller
% 504948475053
Stromkennzahl lt. Hersteller
0,66 0,72 0,76 0,80 0,77 0,75
Motorlaufzeit
Std./Jahr 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
realer Wirkungsgrad
el
% 303233343536
realer Wirkungsgrad
therm
% 403938384042
Zündölanteil
% 101010 10
Zündölverbrauch
l/Jahr 13.652 17.183 33.732 49.479
Heizwert Zündöl
kWh/l 101010 10
Bruttoenergie im Zündöl
kWh/Jahr 136.521 171.832 337.316 494.790
zugeführte Bruttoenergie insgesamt
kWh/Jahr 1.365.210 1.718.320 3.373.164 4.947.896 6.950.103 10.408.399
berechnete Leistung
kW 51 69 139 210 304 468
installierte Leistung
kW 55 75 150 220 330 500
Energieerzeugung
Bruttoenergie
gesamt
kWh/Jahr 1.365.210 1.718.320 3.373.164 4.947.896 6.950.103 10.408.399
kWh
el
/Jahr
409.563 549.862 1.113.144 1.682.285 2.432.536 3.747.024
kWh
el
/Tag
1.122 1.506 3.050 4.609 6.664 10.266
davon Wärmerzeugung
kWh
therm
/Jahr
546.084 673.581 1.295.295 1.880.201 2.780.041 4.413.161
davon Stromerzeugung
entfällt
Summe
Zündstrahl-Motor Gas-Otto-Motor
t FM/Jahr
theoretischer ø Abbaugrad oTS
Gasertrag

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung
126
Verfahrensablauf gewährleistet ist. Auf die Dimensio-
nierung dieser Bauteile wird hier jedoch nicht näher
eingegangen. In der in Kapitel 6.3.3 einzusehenden
Investitionsberechnung für die Modellanlagen wird
die unterschiedliche Auslegung der Bauteil-Kapazitä-
ten jedoch berücksichtigt.
6.3.2.1 Verfahrensschritt Substratannahme und
-vorbereitung
Annahmebehälter
Der Annahmebehälter ist meist als Betonbehälter aus-
geführt und mit einer Leckerkennung ausgestattet.
Er dient der Anmischung der Einzelsubstrate und
der Zwischenspeicherung des Substratgemisches. Das
Füllvolumen sollte so bemessen sein, dass eine Vor-
haltekapazität für einen Zeitraum von etwa 1 bis 3
Tagen erreicht wird. Der Annahmebehälter muß abge-
deckt sein (z. B. über eine Betonplatte).
Ein Füllschacht für das Befüllen mit z. B. Silagen
oder anderen Kofermenten, die keiner besonderen
Vorbehandlung bedürfen, sollte bei kleineren Kosub-
stratchargen vorgesehen werden. Der Füllschacht
kann über eine Klappe abgedeckt werden.
Mit Hilfe eines oder mehrerer zeitgesteuerter
Tauchmotorrührwerke werden die Substrate homoge-
nisiert.
Innerhalb des Annahmebehälters wird ein
TS-Gehalt der Substratmischung von etwa 16 % einge-
stellt. Zur Einstellung des TS-Gehaltes kann u. U. ver-
gorenes Substrat aus dem Gärrestlager mit Hilfe einer
Pumpe dem Annahmebehälter zugeführt werden.
Die Substratmischung aus dem Annahmebehälter
wird mit einer Pumpe zeitgesteuert dem Fermenter
zugeführt.
Der Pumpe ist ein Zerkleinerer/Schneidwerk vor-
geschaltet, um grobe Stoffe oder langhalmige Kompo-
nenten der Substrate zu zerkleinern und für den bio-
logischen Abbau aufzuschließen.
In der Praxis können häufig Güllegruben am Stall
genutzt werden, um Gülle für den Fermentationspro-
zess vorzuhalten. Dazu muss diese Grube jedoch
bestimmte Anforderungen erfüllen:
- Abdeckung verfügbar oder aber problemlos nach-
rüstbar
- Mindestfüllvolumina :
- 1 bis 2-tägige Vorhaltekapazität für die Substrat-
masse Gülle, falls zusätzlich ein Annahmebehäl-
ter errichtet wird
- 3 bis 4-tägige Vorhaltekapazität für die Substrat-
masse Gülle, falls kein Annahmebehälter zusätz-
lich errichtet wird
- Rührmöglichkeit vorhanden oder problemlos nach-
rüstbar.
Die Möglichkeit der Einbindung und Nutzung der
Güllegrube in den Verfahrensablauf sollte vom Anla-
genplaner geprüft werden.
Feststoffeinbringung
Die unterschiedlichen Verfahren und Ausführungen
der Feststoffeinbringung sind ausführlich in Kapitel 5
beschrieben.
Der Befülltrichter der Einbringung sollte mindes-
tens 1 bis 2 Tages-Substratcharge(n) fassen können.
Vorlagebehälter für Kofermente
Für viele hygienisierungspflichtige Stoffe ist eine ge-
sonderte Annahme und Vorlage von Vorteil.
Das Material wird meist in regelmäßigen Abstän-
den an den landwirtschaftlichen Betrieb angeliefert.
Je nach Materialeigenschaften sollte der Vorlagebe-
hälter als Betongrube oder auch als Stahltank ausge-
führt sein.
Werden z. B. Fette angeliefert, so sollten diese in
einem wärmeisolierten Vorlagebehälter gelagert wer-
den, damit die Konsistenz des angelieferten, warmen
Fettes ein Weiterpumpen erleichtert und die Ablage-
rungen im Rohrleitungssystem minimiert werden.
Weiterhin wird ein Festfahren verhindert.
Die Dimensionierung des Vorlagebehälters richtet
sich nach dem Anlieferungsintervall.
Die Komponentenausstattung des Beton-Vorlage-
behälters ist baugleich mit der des Annahmebehälters.
Falls das Material des Vorlagebehälters hygienisie-
rungspflichtig ist, ist eine gesonderte Pumpe für die
zeitgesteuerte und chargenweise Zufuhr des Materi-
als in eine Hygienisierungseinrichtung notwendig.
Hygienisierung
Diese besteht aus einem oder mehreren wärmeisolier-
ten Verweilbehältern, die an den Heizverteiler des
BHKW angeschlossen sind, so dass das Material min-
destens 60 min bei Temperaturen über 70 °C gehalten
werden kann. Die Dimensionierung des/der Verweil-
behälter richtet sich nach dem Fermenterbeschik-
kungsintervall.
Sowohl der Füllstand und die Temperatur in
jedem Verweilbehälter als auch die Temperaturen des
zu- und abgeführten Substrates werden angezeigt
und registriert. Dadurch ist eine lückenlose Doku-
mentation über den Hygienisierungsverlauf gegeben.
Das hygienisierte Material wird nach einer Halte-
zeit von 1 h über eine gesonderte Pumpe in den Fer-
menter gepumpt.

Modellanlagen
127
Vorbereitungstechnik
Vorbereitungstechniken müssen bei Materialien ein-
gesetzt werden, deren physikalischer Zustand wenig
Ansiedlungs- und Zersetzungsflächen bietet.
Bei Verwendung des Substrates „Roggen (Korn)“
bietet sich z. B. der Einsatz einer Quetsche an.
Die angeschlagenen Roggenkörner können dann
per Radlader oder Elevator einem Annahmebehälter
oder einer Feststoffeinbringung zugeführt werden.
Letztere Einbringtechnik bietet den Vorteil, dass
die angeschlagenen Körner ohne Zwischenlagerung
im Annahmebehälter, in dem sie durch Quellprozesse
zu einer Schwimmdeckenbildung beitragen, problem-
los dem Fermenter zugeführt werden können.
6.3.2.2 Verfahrensschritt Fermentation
Die Fermentation findet im mesophilen Temperatur-
bereich zwischen 35 °C und 40 °C statt.
Der Fermenter ist als ein volldurchmischter Durch-
laufreaktor aus Beton mit Dämmung und Trapez-
blechverkleidung ausgeführt. Er ist mit einer Heizung
versehen, die die Wärmeverluste kompensiert und
die Wärmeenergie für die Aufheizung der zugeführ-
ten Substrate bereitstellt.
Der Fermenter ist mit einer Leckerkennung ausge-
stattet.
Die mittlere hydraulische Verweilzeit des Substrat-
gemisches sollte mindestens 30 Tage betragen und so
ausgelegt sein, dass eine Raumbelastung von
3,5 kg oTS/m
3
· d eingehalten wird.
Die Substratzufuhr von dem Annahmebehäl-
ter/der Hygienisierung zum Fermenter erfolgt über
eine Substratleitung, die oberhalb des Flüssigkeitsni-
veaus im Fermenter endet.
Die Zufuhr erfolgt zeitgesteuert.
Entsprechend dem zugeführten Substratvolumen
wird ein korrespondierendes Volumen an Gärresten
über eine in die Gärflüssigkeit eingetauchte Überlauf-
leitung in das Gärrestlager geleitet.
In dem Fermenter sind Tauchmotorrührwerke
installiert, die den Fermenterinhalt in regelmäßigen
Zeitabständen durchmischen und somit der Sink-
schicht- und Schwimmdeckenbildung vorbeugen.
Mindestens ein Sichtfenster im Fermenter ist für
Kontrollarbeiten unabdingbar, weiterhin dient diese
Öffnung als Revisionsöffnung.
6.3.2.3 Verfahrensschritt Biogasspeicherung und
-aufbereitung
Über dem Flüssigkeitsniveau des Fermenters ist ein
Gasraum, der mit einer gasdichten Membran abge-
schlossen ist. Diese Membran dient als Gasspeicher,
sie ist dehnbar, bei gefülltem Speicher ist sie halbku-
gelförmig ausgebildet.
Eine über eine Mittelstütze getragene Holzkon-
struktion verhindert das Absinken der Membran auf
den Flüssigkeitsspiegel im Fermenter.
Die Membran („Gasblase“) wird von außen durch
eine fest installierte wetterfeste Folie vor Witterungs-
und Windeinflüssen geschützt.
In dem durch die Vergärung entstehenden Biogas
können erhebliche Mengen an Schwefelwasserstoff
(H
2
S) enthalten sein.
Aus diesem Grund ist für den Fermenter eine bio-
logische Entschwefelung im Gasraum vorgesehen.
Hierfür wird mit Hilfe einer Membranluftpumpe eine
geringe Menge Luft geregelt in den Gasraum einge-
blasen.
An dem Fermenter ist eine Über- und Unterdruck-
sicherung am Gasraum angeschlossen.
Das in dem Fermenter anfallende und gespeicherte
Biogas ist warm und feucht.
Für die Gasverwertung ist das Gas zu kühlen und
der kondensierende Wasserdampf abzuleiten.
Hierfür ist eine entsprechend dimensionierte Erd-
leitung mit stetigem Gefälle zu einem Kondensat-
schacht vorgesehen.
In der Erdleitung anfallendes Kondensat wird
innerhalb des Kondensatschachtes in einer Wasser-
vorlage abgeschieden. Die Wasservorlage verhindert
das unkontrollierte Entweichen von Gas. Im Konden-
satschacht ist eine Kondensatpumpe installiert, die
niveaugesteuert das Kondensat dem Endlager
zuführt.
6.3.2.4 Verfahrensschritt Gasverwertung
Für die Gasnutzung ist ein Zündstrahl-BHKW oder
Gas-Otto BHKW mit Generator vorgesehen.
Vor dem Aggregat ist eine Flammendurchschlagsi-
cherung vorgesehen.
Um das Gas in dem Gas-Otto-BHKW nutzen zu
können, muss der Gasdruck mit Hilfe eines Verdich-
ters erhöht werden. Die Leistung des Verdichters wird
geregelt.
Vor jedem Apparat ist eine Flammendurchschlag-
sicherung vorgesehen, vor dem Verdichter ist diese als

Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung
128
Kiestopf ausgeführt. Das in dem Kiestopf anfallende
Kondensat wird dem Kondensatschacht zugeführt.
In dem BHKW wird das Biogas verbrannt und mit
Hilfe des Generators in Strom umgewandelt. Die hier-
bei anfallende Wärme wird im Prozess zur Beheizung
des Fermenters und ggf. der Hygienisierung genutzt.
Darüber hinaus verfügbare Wärme aus dem
BHKW kann zu anderen Heizzwecken genutzt wer-
den (Wohnhaus-, Gebäude-, Stallbeheizung, Trock-
nung, externe Wärmeabnehmer).
Überschüssige Wärme wird über einen Notkühler
abgeführt.
Gemäß den Sicherheitsrichtlinien für landwirt-
schaftliche Biogasanlagen ist die bei Ausfall der Gas-
nutzung abzublasende Gasmenge auf maximal
20 m³/h zu begrenzen. Dementsprechend muss für
alle Modellanlagen eine Gasfackel bzw. ein Gasbren-
ner vorgesehen werden. Im praktischen Betrieb ist
auch der Einsatz einer mobilen Gasfackel möglich.
Die Gasfackel wird automatisch druckgesteuert in
Betrieb gesetzt.
Auch vor der Gasfackel ist eine Flammendurch-
schlagsicherung installiert.
6.3.2.5 Verfahrensschritt Gärrestlagerung
Für die Speicherung der anfallenden Gärreste ist ggf.
das bereits aus der Tierhaltung vorhandene Güllela-
ger vorgesehen. Der Gärrestanteil aus der zusätzli-
chen Vergärung von Kosubstraten muss hingegen ad-
äquat gelagert werden.
Als zusätzlicher Gärrestlagerbehälter wird ein
Betonrundbehälter vorgesehen.
Die Auslegung des Gärrestlagers bezieht sich auf
einen 180-tägigen Lagerzeitraum. Bei Modellanlagen,
die als Gemeinschaftsanlagen konzipiert sind und an
dem Ort errichtet werden, an dem auch die Tierhal-
tung angesiedelt ist, ist nur die zusätzliche Investition
durch Kosubstratlagerung kalkuliert. Am Biogas-
standort anfallender Wirtschaftsdünger sowie
Wirtschaftsdünger anderer an der Gemeinschaft betei-
ligter Betriebe wird nicht in die Lagerkapazitätsbe-
rechnung aufgenommen, d.h. nach Anlieferung und
Abgabe von Frischgülle eines an der Gemeinschaft
beteiligten Betriebes an den Biogasstandort wird dem
Gärrestlager Gärrest zur Lagerung bei dem anliefern-
den Betrieb entnommen. So werden Lagerkapazitäten
voll ausgenutzt und Leerfahrten vermieden.
Weiterhin wird bei der Berechnung des zusätzli-
chen Lagerkapazitätsbedarfes ein Abbaugrad der
organischen Trockensubstanz der Kofermente in
Höhe von 50 % unterstellt.
Der Behälter wird mit einer Abdeckung versehen.
Diese ist nicht gasdicht ausgeführt und dient dem-
nach auch nicht als Biogasspeicher für aus dem Gär-
restlager entweichendes Biogas, jedoch wird das
Emissionspotenzial aus dem Gärrestlager erheblich
vermindert (vgl. Kapitel 8).
Innerhalb des Gärrestlagers sind ein bzw. zwei
Tauchmotorrührwerke installiert.
Das Lager ist ggf. über eine Leitung mit dem vor-
handenen Güllebehälter verbunden. Im Gärrestlager
ist höhenverstellbar eine Entnahmemöglichkeit instal-
liert, um Gärrest, u.a. auch für die Verdünnung der
Substratmischung im Annahmebehälter, entnehmen
zu können.
6.3.2.6 Verfahrens-Kenndaten der Modellanlagen
Modellanlage 1
Einzelbetriebliche Anlage mit Rinderhaltung
120 GV, NaWaRo-Einsatz
Die Modellanlage 1 wird ausschließlich mit Substra-
ten vom eigenen Hof betrieben. Es werden Rinder-
gülle, Futterreste aus der Rinderfütterung und ein Ge-
misch aus Gras- und Maissilage eingesetzt. Ein
geringer Teil des vergorenen Materials wird zurück-
geführt, um die Gülle-Silagemischung auf einen
pumpfähigen TS-Gehalt von 16 % zu verdünnen. Das
zurückgeführte Material wird als nicht zum Biogaser-
trag beitragende Lösung angesehen, es wird also bei
der Berechnung der Biogasausbeute aus den verwen-
deten Substraten nicht berücksichtigt.
Anhand des folgenden Verfahrensfließbildes (Abb.
6-2) kann der Substrat- und Biogasfluss nachvollzo-
gen werden, Tabelle 6-10 gibt dann eine Übersicht
über in Modellanlage 2 verwendete Baugruppen
sowie ihre Dimensionierung.
Modellanlage 2
Einzelbetriebliche Anlage mit Mastschweinehal-
tung 160 GV, NaWaRo-Einsatz
Die Modellanlage 2 wird einzelbetrieblich organisiert.
Neben hofeigenen Substraten wie Schweinegülle und
Maissilage wird der Nachwachsende Rohstoff Roggen
(Korn) zu 40 % selbst erzeugt und zu 60 % zugekauft
und eingesetzt.
Anhand des folgenden Verfahrensfließbildes
(Abb. 6-3) kann der Substrat- und Biogasfluss nach-
vollzogen werden, die Tabelle 6-11 gibt dann eine
Übersicht über in Modellanlage 2 verwendete Bau-
gruppen sowie ihre Dimensionierung.
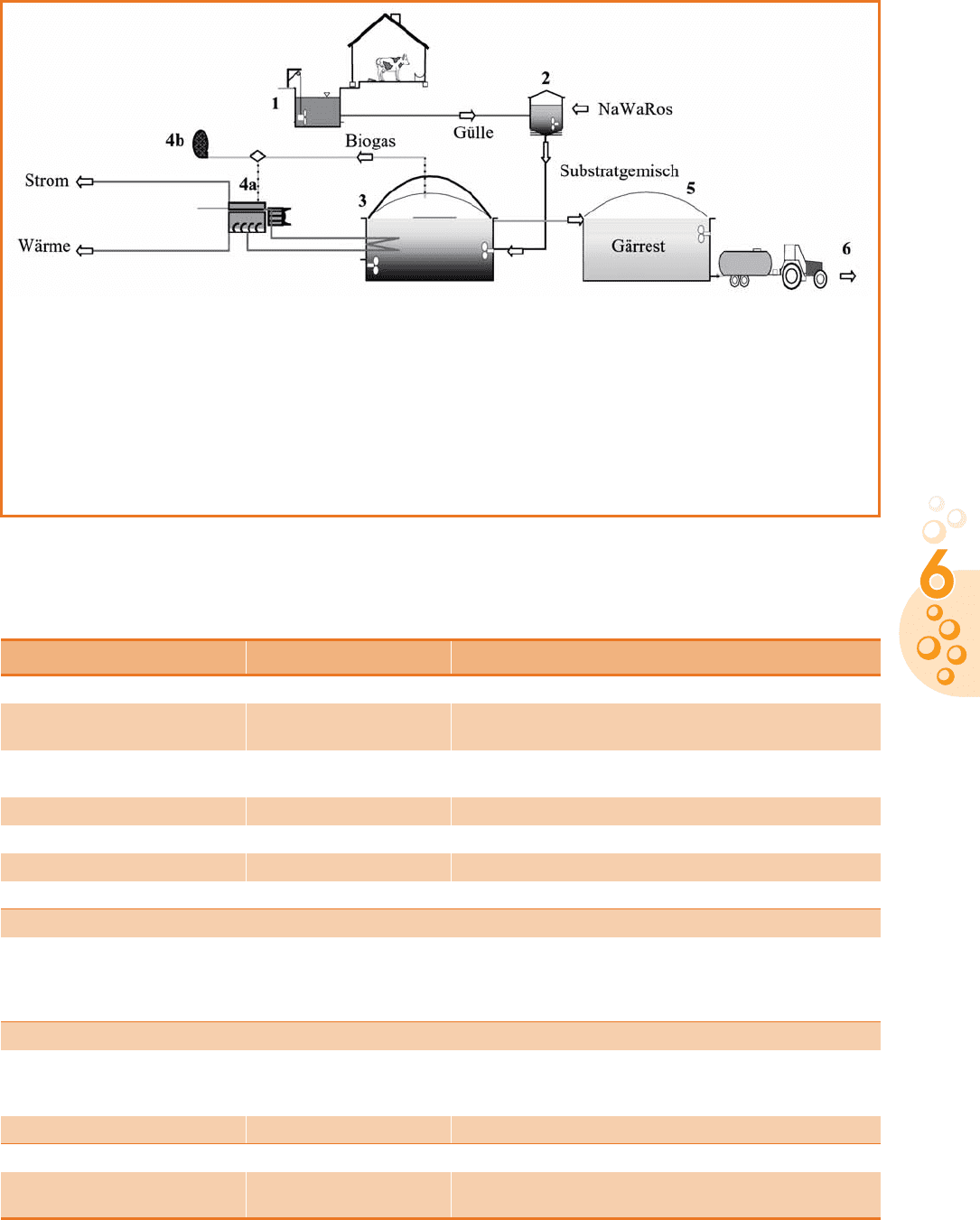
Modellanlagen
129
Verfahrensschritte:
1 Güllevorgrube
2 Annahmebehälter mit Befüllschacht für NaWaRos
3 Fermenter mit Biogasspeicher und Entschwefelung
4 Gasverwertung mit: 4a: BHKW-Modul
4b: Gasfackel
5 Gärrestlager mit Abdeckung
6 Ausbringung
Abb. 6-2: Verfahrensfließbild der Modellanlage 1
Tabelle 6-10: Übersicht über Baugruppen der Modellanlage 1
Verfahrensschritt/ Baugruppe Dimensionierung (brutto) Besonderheiten / Funktion
Substratannahme und -vorbereitung
Güllegrube am Stall 1 bis 2-tägige
Vorhaltekapazität
wird verwendet als Güllevorlage
Annahmebehälter 35 m³ Anmischung von Gülle aus Güllegrube und per Radlager
über Füllschacht zugeführtem Gras-Maissilagegemisch
Feststoffeinbringung --- ---
Vorlagebehälter für Kosubstrate --- ---
Hygienisierung --- ---
Vorbereitungstechnik --- ---
Fermentation/Gasaufbereitung
Fermenter 420 m³ gasdichte Doppelmembran-Abdeckung zur Gasspeicherung
interne biologische Entschwefelung
45 d Verweilzeit des Gärsubstrates Raumbelastung:
3,3 kg oTS/m³·d
Gasverwertung
BHKW 55 kW
el
Zündstrahl-BHKW
Installierte Leistung
Laufzeit: 8.000 h/a unter Volllast
Gasfackel 30 m³ Biogas/h
Gärrestlagerung
zusätzlicher Lagerbehälter aus
Kosubstratvergärung
420 m³ Abdeckung zur Emissionsminderung
Rückführung von Gärrest-Anteil zu Annahmebehälter
